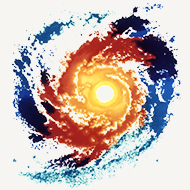TEIL C
TEIL C
SolarhÄuser und solare Bauelemente (2021)
In der diesjährigen Übersicht soll vorneweg der aktuelle Stand beim Thema Fassadenbegrünungen betrachtet werden, das immer häufiger in den Medien erscheint oder in Form von Ausstellungen behandelt wird.
So läuft vom Januar bis zum Juli 2021 im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main die Ausstellung Einfach Grün – Greening the City, das die Großstadt als Dschungel zeigt, mit einer urbanen Begrünung von Balkonen, Dächern, Hinterhöfen und eben Hauswänden. Der Katalog, den das Museum zur Ausstellung herausgibt, ist auch ein Handbuch, das Nachhilfe bei der Planung lebender Wände oder Dächer bietet.
Bevor die jüngsten Entwicklungen dokumentiert werden, soll aber noch auf einen wichtigen Vorläufer hingewiesen werden, den französischen Botaniker, Gartenarchitekten und Künstler Patrick Blanc, der international als Pionier der Pflanzenwand (mur végétal) bekannt wurde. Blanc studierte Naturwissenschaften, spezialisierte sich auf tropische Pflanzen und erforschte ab den 1970er Jahren deren Lebensweise und begann, erste Pflanzenwände zu entwerfen.
Sein Name ist hauptsächlich mit der 800 m2 großen Pflanzenwand verknüpft, die er im Jahr 2004 am Musée du quai Branly in Paris schuf - und mit dem sechs Stockwerke hohen Teppich aus rund 15.000 Pflanzen von 250 verschiedenen Arten, mit denen er 2008 das CaixaForum in Madrid bedeckte. Blanc wird für seine Arbeiten vielfach ausgezeichnet, unter anderem als Ehrenmitglied des Royal Institute of British Architects.

(Grafik)
Ebenfalls im Januar 2021 stellt das von Nuru Karim im Jahr 2010 gegründete Büro NUDES Architecture mit Sitz in Mumbai ein People’s Tower genanntes Projekt vor, einen Observatoriumsturm, der sich auf die Integration von Natur, Technologie und Bürgerbeteiligung konzentriert. Der sich wellenförmig in den Himmel windende Turm besitzt eine Hülle aus 11.520 Topfpflanzen, von denen jede einzelne von Mitgliedern der Gemeinschaft und anderen Akteuren gesät und gepflegt wird, bevor sie an ihren Platz kommt.
NUDES zufolge sind „Topfpflanzen ein universelles Symbol, das unseren grundlegenden menschlichen Urinstinkt für Leben und Überleben repräsentiert. Tausende von Töpfen kommen zusammen, um Ideologien wie Einheit, Frieden, Toleranz, Pluralismus, Empathie und Mitgefühl gegenüber dem Leben und der Natur widerzuspiegeln.“

(Detail)
Um dies deutlich zu machen, wird der auf dem Net-Zero-Design-Prinzip basierende People’s Tower über versetzte Beobachtungsdecks auf den unterschiedlichen Ebenen verfügen. Diese werden von einem gemeinschaftlichen Amphitheater mit Panoramablick auf der Spitze des Gebäudes gekrönt. Im Inneren gibt es eine spiralförmige Rampe sowie ein durchdachtes Aufzugskonzept.
Das Gießen der tausenden Blumentöpfe wird ein Schwarm von Drohnen übernehmen, die mittels moderner Bildanalysetechnologien auch den Gesundheitszustand der Pflanzen in Echtzeit überwachen. Durch vertikale Leitungen, die in die Infrastruktur des Turms eingebettet sind, wird recyceltes Wasser dann dort versprüht, wo es gerade gebraucht wird. Ob der Entwurf tatsächlich realisiert wird, ist allerdings fraglich.
Im Februar 2021 startet an der Fachhochschule Bielefeld (Hochschule Bielefeld – University of Applied Sciences and Arts, HSBI) unter der Leitung von Jan Lukas Storck ein Forschungsprojekt, um Fassaden auf Basis textiler Substrate zu begrünen – mit Moosen oder Mikroalgen. Die textilen Substrate sollen als Grundlage für eine vertikale platzsparende Kultivierung dienen, wobei das Material alterungsbeständig sein soll, nicht schimmeln darf, mechanisch gute Tragfähigkeit auch im nassen Zustand aufweisen muß, sowie Moosen und Algen guten Halt bietet.

textilen Untergrund
Um den bestmöglichen Untergrund für die Moos-Fassaden zu finden, arbeitet die FH mit der Strickerei Bache INNOVATIVE mit Sitz in Rheinberg zusammen. Die Forschungsergebnisse sollen diese dabei unterstützen, für einen grünen Bewuchs geeignete Textilien, die über eine hohe Wasserspeicherkapazität verfügen und sich ideal mit Konzepten zur automatisierten Kultivierung verbinden lassen, zu entwickeln und zu vermarkten.
Nach rund anderthalb Jahren Projektlaufzeit, im September 2022, können erste Ergebnisse gemeldet werden. Demnach scheint die passive Bewässerung über Kapillarbrücken vielversprechend zu sein, bei der ein Faden mit hoher Kapillarkraft das Wasser aus einem Reservoir aufsaugt. Der Faden ist wiederum in dem Gestrick eingearbeitet, auf dem die Moose wachsen. Versuche laufen dazu nicht nur im Labor, sondern auch auf dem Dach des FH-Gebäudes, wo in Versuchsaufbauten heimische Moose auf verschiedene Textilien aufgenäht werden um u.a. zu testen, welches textile Material - nur durch Regen bewässert - am besten Feuchtigkeit speichert.
Als besonders gut geeignetes Material erweist sich ein zwei- oder dreifädiges Gestrick aus Tencel, einer synthetischen Faser, die aus Holz gewonnen wird. Allerdings speichert dieses Textil große Mengen Wasser und wird sehr schwer, was in der Gebäudestatik berücksichtigt werden muß. Außerdem zeigt sich, daß Moose einfacher einzusetzen sind als Algen, da sie sehr viel besser geeignet sind, um Wasser zu speichern, und weil ihre Wachstumsgeschwindigkeit kontrollierbarer ist als die von Algen.
Zudem soll im Zuge der Projektlaufzeit bis Ende Januar 2023 ein automatisiertes Steuerungssystem für optimale Wuchsbedingungen entwickelt werden. Hierfür werden die Wachstumsbedingungen durch Temperatur-, Feuchtigkeits- und Leitfähigkeitssensoren zur Messung der Nährstoffkonzentration genau überwacht. Und neben der passiven Bewässerung mittels Kapillarkräften wird auch eine aktive, automatisierte Variante durch computergesteuerte Bewässerung realisiert. Das Projekt wird vom Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) mit 220.000 € gefördert.
Übrigens war an der HSBI bereits 2018 das Forschungsprojekt ,Vertikale Landwirtschaft’ gestartet worden, an dem die o.g. Partner gemeinsam mit Prof. Andrea Ehrmann und mit rund 190.000 € finanziert an der Entwicklung unterschiedlichster textiler Substrate auf Basis von Gestricken und Nanovliesen gearbeitet haben, auf denen zukünftig auf kleinstem Raum Nutzpflanzen von marinen Algen über Moose bis hin zu Obst- und Gemüsepflanzen wachsen sollen.

am DITF
In diesem Zusammenhang soll auch darauf hingewiesen werden, daß an den Deutschen Instituten für Textil- und Faserforschung (DITF) in Denkendorf bereits Anfang 2017 ein Forschungsprojekt mit dem Ziel begonnen hatte, ein textilbasiertes, autonomes Living-Wall-System für Innenräume mit integrierter Beleuchtung und Bewässerung zu entwickeln. Diesem Projekt, das bis Ende 2018 lief, folgte ab dem Juni 2020 ein weiteres Projekt, bei dem bis zum Mai 2022 an Living Walls für den städtischen Außenbereich gearbeitet wurde.
Hierbei werden die Pflanzen auf den grünen Fassaden über ein automatisches Bewässerungssystem mit Wasser und Nährstoffen versorgt, wobei sensorische Garne den Wasser- und Nährstoffgehalt erfassen. Indem diese Living Walls weitgehend autonom arbeiten, ist der Aufwand für Pflege und Wartung gering. In dem Forschungsprojekt wird auch die Kühlleistung einer Fassadenbegrünung wissenschaftlich untersucht.

(Grafik)
Es gibt aber auch schon praktische Umsetzungen im großen Format: So beginnt beispielsweise Ende Mai 2021 der Umbau von Halle 36 auf dem Campus des Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg als groß angelegtes Pilotprojekt zur Gebäudebegrünung und Luftkonditionierung.
Dabei sollen die 2.660 m2 große Dachfläche und die 1.910 m2 große Fassade mit rund 25.000 Gräsern, Stauden und Klettergehölzen bepflanzt werden und auch Obst und Blüten tragen, wie Waldrebe, Kiwi und Blauregen. Hamburg unterstützt das Vorhaben mit 410.000 €, das DESY selbst steuert ebenso viel bei, die vollständige Begrünung ist für 2026 geplant.
Motiviert zu dem Vorhaben wurde die Hamburger Umweltbehörde durch Ergebnisse der Humboldt Universität in Berlin, die am eigenen Objekt in Berlin-Adlershof die verschiedenen Parameter der Fassadenbegrünung und Regenwassernutzung als Elemente der Gebäudeklimatisierung mit denen konventioneller Kühlsysteme verglichen hatte, wie die Primärenergieeinsparung und die spezifischen Kosten. Demnach sank der Primärenergiebedarf zum Heizen und Kühlen bei begrünter Südfassade von 57 auf 42 kWh/m2 im Vergleich zu einem konventionellen Sonnenschutz vor der Fassade.
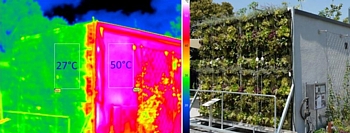
der Versuchsanordnung
Im Oktober 2021 findet am Bayerischen Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. (ZAE Bayern) in Würzburg andie Auftaktveranstaltung für das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geförderte Forschungsvorhaben U-green statt, bei dem typische Fassaden- und Dachbegrünungen bauphysikalisch bewertet und standardisierte Meßverfahren entwickelt werden sollen, um die Begrünungen bei der energetischen Auslegung von Gebäuden berücksichtigen zu können.
Das Projekt wird im Auftrag der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS) durchgeführt, wobei sich das interdisziplinäre Projektteam aus Wissenschaftlern, Ingenieuren und Landschaftsarchitekten der FHWS und der beteiligten Projektpartner TU Berlin, Landesanstalt für Wein- und Gartenbau, Bundesverband GebäudeGrün e.V. (BuGG) und der Bayerischen Architektenkammer zusammensetzt.
Im Rahmen des Projekts sollen handelsübliche Fassaden- und Dachbegrünungssysteme in Klassen unterteilt und anschließend bauphysikalisch und thermisch charakterisiert werden. Ergänzend wird ein Softwaretool entwickelt das zukünftig die bauphysikalische Bewertung von Fassadensystemen für Fachplaner vereinfachen soll. Zudem ist der Aufbau einer frei zugänglichen Datenbank mit den Projektergebnissen geplant.

Eine weitere Arbeit erfolgt unter der Leitung von Matthew Fox an der britischen Plymouth University, wie im Oktober 2021 berichtet wird. In der Studie ,Living wall systems for improved thermal performance of existing buildings’ wird gezeigt, daß lebende Wände nicht nur die Temperatur in neuen Gebäuden, in die sie installiert werden, regulieren können, sondern auch die gleiche Wirkung haben, wenn sie in viel ältere, bestehende Strukturen eingebaut werden.
Bei dem Versuch installiert das Team eine mit Pflanzen gefüllte lebende Wand an einem Abschnitt der nach Westen gerichteten Außenwand eines Gebäudes aus der Zeit vor 1970 auf dem Campus. Das Bauwerk verfügte bereits über gemauerte Hohlraumwände, die aus zwei parallelen, durch einen Luftraum getrennten Teilwänden bestehen. In diesem Fall bestand die Innenwand aus Beton und die Außenwand aus Ziegeln. Neu hinzu kamen eine Reihe von miteinander verbundenen Filztaschen, die jeweils Erde und winterharte Pflanzen enthielten.
Bei Messung der Raumtemperatur und der Wärmeleitfähigkeit der Wände auf der Westseite des Gebäudes über einen Zeitraum von fünf Wochen im November/Dezember wird festgestellt, daß der Bereich mit der Grünwand 31,4 % weniger Wärme verlor als der angrenzende Kontrollbereich. Dementsprechend wird auch weniger Energie benötigt, um diesen Teil des Gebäudes zu heizen. Außerdem sind die Tagestemperaturen in dem mit einer lebenden Wand bedeckten Bereich stabiler, d.h. sie schwanken weniger stark in Abhängigkeit von Faktoren wie Sonneneinstrahlung und Außentemperaturen.

Ebenfalls im Oktober 2021 findet in Düsseldorf die Eröffnung der gegenwärtig größten Grünfassade Europas statt, die in Form einer insgesamt 8 km langen Hainbuchhecke aus über 30.000 Pflanzen den Kö-Bogen II umhüllt, einen neuen Büro- und Geschäftskomplex nach Plänen des ortsansässigen Büros Ingenhoven Architects. Die Fassade wird einerseits geradezu pompös, andererseits aber auch sehr streng und nüchtern, da es nur eine einzige Pflanzenart gibt.
Das Gebäude selbst, dessen Bau offiziell im Juni 2017 begann, während die Fertigstellung im Jahr 2020 erfolgte, besteht aus zwei Volumen mit insgesamt knapp 41.000 m2 Grundfläche für Einzelhandel, Gastronomie und Büros und entspricht einem Nachhaltigkeitskonzept, das sich der Architekt Christoph Ingenhoven unter dem Begriff ,supergreen’ schützen läßt.
Im März 2022 meldet die Presse, daß ab 2024 in
Berlin eine Pflicht zur Dachbegrünung kommen wird. Die neue Bauordnung
sieht vor, daß Dächer mit einer Neigung bis zu 10° begrünt werden
müssen, sofern die Dachfläche größer als 100 m2 ist. Es
gibt Ausnahmen, zum Beispiel für kleine Dächer bis 30 m2 oder
wenn eine andere Nutzung wie PV-Anlagen geplant ist.
Die Regelung ist Teil der Berliner Klimaschutz- und Schwammstadt-Strategie und soll dazu beitragen, die Stadt an den Klimawandel anzupassen, Starkregen zu bewältigen und das Mikroklima zu verbessern. Die Umsetzung erfolgt mit großzügigen Übergangsfristen und Förderprogrammen wie GründachPLUS.
Auch in diesem Jahr gibt es wieder Unmengen neuer Designs und Entwürfe, welche eine Auswahl recht schwer gestalten. Im Januar treten Foster + Partners mit den Lusail Towers in die Öffentlichkeit, als Teil eines größeren Masterplans für Katar, der ebenfalls von dem Architekturbüro entworfen wurde. Die Türme sollen ein neues zentrales Geschäftsviertel in der Stadt bilden und den Hauptsitz der Qatar National Bank, der Qatar Central Bank und der Qatar Investment Authority sowie anderer internationaler Organisationen beherbergen.

(Grafik)
Das insgesamt 1,1 Mio. m2 große Projekt wird aus zwei 70-stöckigen und 301 m hohen sowie zwei 50-stöckigen und 215 m hohen Türmen in einer symmetrischen Anordnung bestehen, deren Zentrum ein öffentlicher Raum im Erdgeschoß ist, der zu 20 % durch eine üppige und größtenteils einheimische Bepflanzung bedeckt sein wird. Zudem werden Grauwasser, Regenwasser und Kondensat recycelt und für die Bewässerung wiederverwendet.
Die abgerundeten Türme sind mit maritimem Aluminium verkleidet und mit verdrehten Sonnenlamellen versehen, die einen optimalen äußeren Sonnenschutz bieten und gleichzeitig eine Reduzierung der freiliegenden Verglasung bewirken. Die sich wandelnde Form basiert auf zahlreichen Studien mit dem Ziel, die harte Sonneneinstrahlung zu begrenzen. Neben den passiven kommen in allen Türmen auch aktive Systeme zum Einsatz, um den Energiebedarf zu reduzieren, wie z.B. Hochdruck-Hydroniksysteme, die die erforderliche Pumpenergie verringern.
Der Cluster aus den vier Türmen wird durch eine Reihe kleinerer Podiumsgebäude ergänzt, die das Projekt auf ein angenehmes menschliches Maß herunterbrechen und das Straßenbild mit Geschäften, Cafés und Restaurants bereichern. Wie die Türme sind auch diese Gebäude auf einen reduzierten Energieverbrauch ausgelegt und verfügen über geformte Betonplatten für eine verbesserte thermische Masse und minimale Fensteröffnungen, um unerwünschte Sonneneinstrahlung zu reduzieren.
Durch eine bedarfsgesteuerte Belüftung, eine zentrale Wärmespeicherung, effiziente LEDs und eine fortschrittliche Automatisierung soll sich der Energiebedarf des Standorts im Vergleich zu einem Referenzgebäude um 35 % senken lassen.

(Grafik)
Nur einen Monat später folgt - ebenfalls von Foster + Partners - der Entwurf für ein buntes, touristisches Inselparadies mit dem Namen Coral Bloom, das in Saudi-Arabien entstehen soll. Es wird Teil des größeren Red Sea Project von Kengo Kuma & Associates aus Tokio sein, zu dem auch der Red Sea Airport gehört, der wiederum von Foster + Partners stammt. Dieses Großprojekt wird sich über 90 derzeit noch unbebaute Inseln zwischen den Städten Umluj und Al Wajh an der Westküste Saudi-Arabiens über eine Fläche von 28.000 km2 an Land und Gewässern erstrecken und nach seiner Fertigstellung 50 Hotels umfassen.
Coral Bloom wird sich auf einer Insel namens Shurayrah (o. Shura Island) befinden, die als Tor zu weiteren 21 unberührten Inseln dienen soll. Alleine auf Shurayrah wird elf Hotels geben, die alle von Foster + Partners entworfen wurden und sich durch den Verzicht auf Korridore und die Konzentration auf Freiflächen und Belüftung auszeichnen. Lange Promenaden und Stege laden zu Spaziergängen ein. Das Gebiet wird auch teilweise neu gestaltet, indem neue Strände und Lagunen angelegt werden, die dazu beitragen sollen, die Insel gegen den steigenden Meeresspiegel zu schützen.
In der Pressemitteilung der zuständigen Red Sea Development Co. (TRSDC) wird betont, daß alle 22 Inseln ausschließlich durch Solarpaneele und Windturbinen mit Strom versorgt werden - die auf den ansprechenden Renderings aber nirgends zu sehen sind. Außerdem wird sich der Komplex auf die „weltweit größte Batteriespeicheranlage“ mit einer Kapazität von 1.000 MWh stützen, um den Strombedarf des gesamten Standorts auch in der Nacht zu decken, ebenso wie bei Sandstürmen, wenn das PV-Kraftwerk abgeschaltet werden muß. Zu den weiteren umweltfreundlichen Merkmalen gehören die Abwasseraufbereitung und die Verwendung von Grauwasser für die Bewässerung.
Eigentlich sollten die ersten Gäste bereits Ende 2022 auf Coral Bloom ankommen, doch noch 2024 ist die Rede davon, daß die Arbeiten an der Infrastruktur ,weit fortgeschritten’ sind und die Fertigstellung der elf Ressorts auf der Insel nun für das vierte Quartal diesen Jahres geplant ist. Die Kernstruktur und Fassaden der vier Türme einschließlich der Lobby-Bereiche wurden im Oktober 2023 abgeschlossen, die endgültige Fertigstellung und Inbetriebnahme ist nun für 2025 erwartet.
Ebenfalls im Januar 2021 präsentiert das internationale Büro MAD Architects erstmals öffentlich die Entwürfe eines Projekts namens Train Station in the Forest - obwohl der Baubeginn bereits Ende 2019 erfolgt ist, wie man nun zu erfährt. Dabei handelt es sich um einen innovativen Bahnhof in der chinesischen Stadt Jiaxing, der von einem üppigen ,grenzenlosen Park’ gekrönt wird, welcher die Natur in die städtische Umgebung zurückbringt.

(Grafik)
Das insgesamt 35,4 Hektar große Projekt umfaßt neben dem neuen Bahnhof zwei öffentliche Plätze, ein Gewerbegebiet, einen Verkehrsknotenpunkt und eine Renovierung des angrenzenden People’s Park. Dabei werden die wichtigsten Verkehrs- und Geschäftsfunktionen unterirdisch untergebracht, während ein weitläufiges, von Bäumen umgebenes Gründach einen ,Bahnhof im Wald’ schaffen wird.
Die Bahnhofsanlage verfügt über eine ,schwebende’ Metall-Dachkonstruktion, auf der Solarpaneele installiert sind, wobei Technologien wie CdTe-Solarglas (Cadmiumtellurid) zum Einsatz kommen, das speziell an die geschwungenen Dachformen angepaßt wurde, um sowohl die Ästhetik als auch die Energieeffizienz zu maximieren. Dabei wird der erzeugte Solarstrom direkt für den Betrieb der Bahnhofsgebäude genutzt, etwa für Beleuchtung, Belüftung und weitere technische Systeme. Damit wird das Dach zur ,ökologischen fünften Fassade’ und ist ein sichtbares Zeichen für nachhaltiges Bauen. Die vollständige Fertigstellung und Eröffnung der Jiaxing Train Station erfolgen im Februar 2024.
Im Januar 2021 stellt der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman erstmals das Projekt The Line öffentlich vor, ein überaus ambitioniertes, von Impact One in Auftrag gegebenes Bauprojekt, bei dem eine Art ,liegender Wolkenkratzer’ für 9 Mio. Bewohner entstehen soll. Der ursprüngliche Plan sieht ein Spine (o. Spine Layer) genanntes, 170 km langes schnurgerades Transport- und Versorgungssystem auf drei Ebenen vor: eine oberirdische für Fußgänger (Pedestrian Layer), eine unterirdische für die Infrastruktur (Service Layer) und eine weitere darunter für den motorisierten Verkehr und eine Hochgeschwindigkeits-U-Bahn.

(Grafik)
Auf der Erdoberfläche sollten entlang des Spine eine Vielzahl von autofreien Gemeinden, die ,city modules’, entstehen, innerhalb derer alle Wege binnen fünf Fußminuten zurückgelegt werden können. Im Juli 2022 wird dann ein überarbeiteter Plan veröffentlicht: Anstelle der Gemeinde-Module mit vielen Einzelgebäuden soll nun oberhalb des Spine ein einziges 500 m hohes und 200 m breites Bauwerk entstehen.
Das Megaprojekt ist ein zentraler Teil von NEOM, einem Siedlungsprojekt im Nordwesten Saudi-Arabiens, das bereits im Oktober 2017 im Rahmen der saudischen Vision 2030 auf der Future Investment Initiative in Riad vorgestellt worden war. Des ,Neo’ im Kunstwort ,Neom’ ist eine Entlehnung aus dem Altgriechischen und repräsentiert das Neue; die Endung ,m’ bezieht sich auf das Arabische und steht für die Zukunft (mustaqbal).
Das Projekt nahe dem Golf von Akaba und der Küste des Roten Meeres, bei dem u.v.a. auch Luxusinseln, ein Wintersportgebiet sowie ein schwimmender Hafen namens Oxagon geplant sind, umfaßt eine Fläche von etwa 26.500 km2 – etwas weniger als Belgien – und soll eine unabhängige Wirtschaftszone mit eigenem Rechts- und Steuersystem werden. Die Kosten werden anfangs auf 500 Mrd. $ geschätzt.
The Line, das von dem kalifornischen Büro Morphosis entworfen ist und nach Fertigstellung der Hauptwohnsitz für fast alle Bewohner von NEOM werden soll, wird schnell das bekannteste Teilvorhaben. Dabei soll die 170 km lange Bandstadt ausschließlich mit Solar- und Windenergie betrieben werden. Zusätzlich sind innovative Mobilitätskonzepte wie Hochgeschwindigkeitszüge, autonome Fahrzeuge und Lufttaxis vorgesehen, ebenfalls mit erneuerbarer Energie betrieben. Die Kühlung soll passiv erfolgen: Der Pedestrian Layer ist in der Mitte offen, so daß warme Luft nach oben entweichen soll. Die Gebäude haben begrünte Dächer.

(im Bau)
Der auf einer Fläche von 34 km2 zu bauende Turm würde eine stark verspiegelte Oberfläche aufweisen, während im Inneren öffentliche Parks und Fußgängerzonen, Schulen, Wohnungen und Arbeitsplätze übereinander geschichtet sind und die Menschen die Möglichkeit haben, sich nahtlos in drei Dimensionen zu bewegen, um sie in höchstens 5 Minuten zu erreichen.
Das Konzept wird reichlich übertrieben als ,Zero Gravity Urbanism’ bezeichnet, geht vermutlich aber auf die von Prof. Carlos Moreno an der Pariser Sorbonne entwickelte und bereits 2016 vorgestellte ,15-Minuten-Stadt’ zurück, in der alle wichtigen Einrichtungen und Dienstleistungen für die Bewohner innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sind. Bei dieser menschenzentrierten Stadtentwicklung werden Nachbarschaften autarker und lebenswerter und der Alltag ist ohne Auto möglich.
Im Gegensatz zu vielen anderen angekündigten Großprojekten beginnen die Erdbauarbeiten an der vertikalen Megacity tatsächlich bereits im Oktober 2021, und Drohnenaufnahmen ein Jahr später belegen den Fortschritt, den die Bagger machen. In der deutschen Presse wird das Projekt trotzdem weiterhin regelmäßig und leicht abwertend als „ein Märchen aus 1001 Nacht“ bezeichnet.
Gleichzeitig kommt zunehmend Kritik gegenüber Menschenrechtsverletzungen und Zwangsräumungen seitens der saudischen Behörden auf, da bereits 2020 ein Demonstrant des Beduinenstamms der Huwaitat erschossen wurde, der gewaltsam von seinem Land vertrieben wurde, das er für NEOM nicht aufgeben wollte. Im Juli 2022 werden die Bewohner des Küstendorfs Maqna deportiert - insgesamt sollen 28.000 Menschen zum Umzug gezwungen werden.

(Schnittmodell)
Im Oktober werden drei Männer zum Tode verurteilt, darunter der Bruder jenes ermordeten Beduinen, nachdem auch sie gewaltsam aus ihren Wohnorten vertrieben worden waren. Die Menschenrechtsorganisation ALQST dokumentiert die Geschehnisse ausführlich. Darüber hinaus gelten die Arbeits- und Lebensbedingungen für die Arbeiter auf den Baustellen, die zumeist aus Indien und Pakistan kommen, als inakzeptabel.
Kritik an der Linienform der zwei ununterbrochenen Reihen von Wolkenkratzern kommt wiederum von Wissenschaftlern des Complexity Science Hub (CSH), einem unabhängigen Forschungsinstitut mit Sitz in Wien, die davon ausgehen, daß es wesentlich vorteilhafter wäre, die Stadt kreisförmig zu bauen: „Eine lineare Form ist die am wenigsten effiziente Form einer Stadt. Es gibt einen Grund, warum die Menschheit 50.000 Städte hat, und alle mehr oder weniger rund sind.“
Es wird auch befürchtet, daß zahlreiche Tierarten, einheimische, wandernde, domestizierte und invasive, sowohl lokal als auch aus der Ferne beeinträchtigt werden, wenn The Line verwirklicht wird, das eine riesige und für viele Arten undurchdringliche Barriere in der Landschaft sein werde. Am stärksten gefährdet sind Vögel, die die spiegelnde Oberfläche nicht erkennen und dagegen fliegen. Zumal The Line auf einer wichtigen Zugvogel-Route entsteht.
Im Februar 2023 wird bekanntgegeben, daß inzwischen rund ein Fünftel der Grundarbeiten fertiggestellt wurden, und wiederum ein Jahr später zeigt ein neues Video die größten Erdarbeiten der Welt, mit Baggern und Lastwagenkolonnen, die rund um die Uhr zugange sind, um jede Woche Millionen von Kubikmetern Erde und Wasser zu bewegen und die notwendigen Fundamente für das Gebäude vorzubereiten, das nun schon in einem Zug mit den Pyramiden von Gizeh und der Chinesischen Mauer genannt wird.

(im Bau)
Im April 2024 meldet die Presse, daß der Bau der futuristischen Bandstadt, der eigentlich 2049 fertig sein sollte, langsamer voran geht als geplant. Nennenswerten Fundamente oder gar Gebäude gibt es noch keine. Die Behörden in Saudi Arabien korrigieren ihre Ambitionen nach unten, denn das Ziel der Phase 1 von 1,5 Mio. Einwohnern bis 2030 ist offensichtlich nicht zu halten. Inzwischen gehen sie von 300.000 (später: 200.000) aus. Der Grund ist, daß bis dahin wohl nur 2,4 (später: 2,5 km) der geplanten 170 km fertig gebaut sein werden.
Trotzdem hält die Regierung an NEOM und dessen Komponenten fest und belegt dies im August in Form einer Initiative namens Ground X, die Investoren und Verkäufern mit Fotos von den Fortschritten und Live-Webcams beweisen soll, daß alles im Plan ist. Im Oktober wurden dann einige neue Baudetails bekannt gegeben.
Demnach wurde jetzt ein neues Betonwerk im Wert von fast 190 Mio. $ in Betrieb genommen, das bis zu 20.000 m3 Beton pro Tag produzieren kann, wovon der größte Teil für The Line und der Rest für andere NEOM-Projekte bestimmt ist. Außerdem sind aktuell mehr als 100.000 (andere Quellen: 140.000) Arbeiter rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche im Einsatz, um Platz für die massiven Fundamente zu schaffen. Darüber hinaus sind durch die bayerische Bauer Gruppe bereits fast 1.000 der über 30.000 Gründungspfähle mit einem Durchmesser von 2,5 m 70 Meter tief in den Wüstensand gesetzt worden. Jede Woche kommen über 120 weitere hinzu. Außerdem soll das Projekt derzeit ein Fünftel des weltweit produzierten Stahls verbrauchen.
Ebenfalls im Oktober 2024 strahlt der britische Fernsehsender ITV den Dokumentarfilm Kingdom Uncovered: Inside Saudi Arabia aus, in welchem berichtet wird, daß seit dem Beginn der Arbeiten an dem Megaprojekt NEOM im Jahr 2017 schon mehr als 21.000 Arbeiter gestorben seien, viele von ihnen aus Indien, Bangladesch und Nepal. Laut einem Bericht der indischen, englischsprachigen Tageszeitung The Hindustan Times sind zudem mehr als 100.000 Menschen während des Baus verschwunden.

Zeitgleich wird der erste Teil von NEOM realisiert, das 83 Hektar große, exklusive Inselparadies Sindalah, das 5 km vor der Festlandsküste liegt und derzeit schrittweise eröffnet wird. Im November folgen Informationen zu den Auftragnehmern: Demnach wurde das US-Büro Gensler mit der Realisierung beauftragt, während das österreichische Büro Delugan Meissl Associated Architects die städtebaulichen Planung übernimmt. Für die städtische Infrastruktur wird das britische Unternehmen Mott MacDonald hinzugezogen.
Zur Steigerung der Arbeitseffizienz und Senkung der Betriebskosten tätigt der strategische Investitionszweig von Neom, der Neom Investment Fund (NIF), im Dezember eine bedeutende Investition in das europäische Unternehmen GMT Robotics. Mit den Hightech-Robotern sollen die Arbeiten beschleunigt werden, wie z.B. die Herstellung von Bewehrungsstäben.
Im Januar 2025 werden auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos weitere Details bekanntgegeben, so auch, daß es „100 Jahre oder so“ dauern könnte, bis The Line mit 9 Mio. Menschen gefüllt sein wird. Die Stadt soll zudem nahezu komplett autark funktionieren und „letztlich komplett mit erneuerbaren Energien betrieben“ werden, was durchaus Raum für Interpretationen läßt.
Meldungen im Februar bestätigen, daß der erste Abschnitt bis 2030 fertiggestellt werden soll, der aus drei miteinander verbundenen, jeweils 800 m langen Modulen besteht, so daß quasi auf dem Dach von The Line in 350 m Höhe ein Stadion für die Fußballweltmeisterschaft 2034 entstehen kann, das 45.000 Zuschauer faßt. Dieser Bauabschnitt soll mit der Hidden Marina zudem einen versteckten Hafen umfassen, der sich im Innern der Stadt befinden und groß genug sein wird, daß dort auch Kreuzfahrtschiffe anlegen können. Ein Kanal führt in einem 90°-Winkel auf die lange Front der Stadt. Als Umfang der Investitionen in die Infrastruktur werden nun 140 Mrd. $ genannt.
Im Mai 2025 erscheinen jedoch Meldungen, daß die Kosten aus dem Ruder laufen. Demnach könnten sich die Gesamtkosten von NEOM auf 8,8 Billionen Dollar belaufen - das mehr als 25-Fache des jährlichen saudischen Staatsbudgets. Bereits für die Bauphase bis 2035 sind 370 Mrd. $ vorgesehen, was für die ambitionierten Pläne aber offenbar nicht ausreicht. Ein zentrales Problem ist der Standort, da die extrem abgelegene Wüstenregion den Bau zu einer logistischen Herausforderung macht.
Ein interner Bericht spricht zudem von „Beweisen für vorsätzliche Manipulation“ finanzieller Kennzahlen durch das Management mit dem Ziel, den Kronprinzen mit geschönten Zahlen bei Laune zu halten. Und Fachleute der University of Illinois befürchten, daß The Line nach der Fertigstellung unkalkulierbare Auswirkungen auf die lokalen klimatischen Bedingungen haben könnte, wie die Veränderung von Niederschlagsmengen und -mustern sowie eine Verstärkung von Wind und Sandstürmen.
Zurück zur allgemeinen Jahresübersicht: Im Februar 2021 wird
erstmals der von NBBJ,
einem globalen amerikanischen Architektur-, Planungs- und Designbüro
gestaltete Entwurf für den Amazon-Hauptsitz HQ2 in
Arlington veröffentlicht. Das knapp 107 m hohe Gebäude hat die Form
einer Spirale und trägt den naheliegenden Namen The Helix.
Die 22 Stockwerke bieten eine Nutzfläche von ca. 34.370 m2,
wobei die Innenräume den Mitarbeitern eine Vielzahl von alternativen
Arbeitsumgebungen bieten werden.
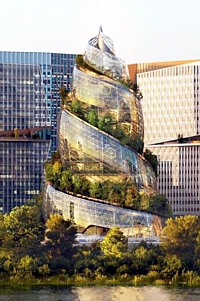
(Grafik)
Die Fassade besteht überwiegend aus Glas und besitzt zwei spiralförmige, begehbare Außenwege, die öffentlich zugänglich und mit üppiger Vegetation und einheimischen Bäumen bepflanzt sind. Ein Amphitheater mit Blick auf eine weitläufige zentrale Grünfläche wird Platz für Freiluftkonzerte, Bauernmärkte und Filme im Park bieten, während sich auf dem gesamten Gelände Einzelhandelspavillons und Restaurants verteilen.
Das Design wird durch ca. 10.000 m2 öffentliche Grünflächen unterstützt, es gibt neue Radwege, 950 Fahrradstellplätze und eine unterirdische Verkehrsführung. Ein 20.000 m2 großer Gemeinschaftsraum soll zudem Bildungsinitiativen unterstützen. Außerdem wird ein zentrales Heiz- und Kühlsystem installiert, das zu 100 % mit erneuerbarer Energie betrieben wird: Mit dem Strom einer Solarfarm in Virginia.
Der Baubeginn war ursprünglich für 2022 geplant, mit einer angestrebten Fertigstellung im Jahr 2025. Bislang gibt es jedoch keine Hinweise darauf, daß das Gebäude tatsächlich schon in Arbeit ist.
Im März 2021 geben
das Burning Man Project und
die Land Art Generator Initiative (LAGI) die zehn
besten Entwürfe des im Januar letzten Jahres gestarteten LAGI
2020 Fly Ranch Design-Wettbewerbs bekannt. Die Aufgabe bei
diesem globalen Ideenwettbewerb war es, eine netzunabhängige Ranch
im Great Basin als nachhaltigen, ganzjährigen ,Inkubator für die
Burning Man-Kultur’ neu zu gestalten.
Die Fly Ranch ist ein 3.800 Hektar großes Grundstück nördlich der jährlichen Burning Man-Veranstaltung in Black Rock City im Norden Nevadas, das dutzende heiße und kalte Quellen, drei Geysire, hunderte Hektar Feuchtgebiete, dutzende Tierarten und mehr als 100 Pflanzenarten beherbergt, weshalb es auch zu Kritik ab den Plänen kommt.
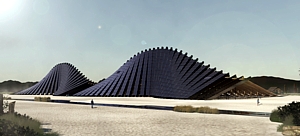
(Grafik)
Das Burning Man Project, das das Fly Ranch-Gelände 2016 erworben hat, hat sich mit LAGI zusammengetan, um Ideen für eine grundlegende Infrastruktur zu finden, da die Fly Ranch - anders als die temporäre Burning Man-Metropole - ein dauerhaftes, netzunabhängiges Ziel werden soll, das das ganze Jahr über Wohnsitze, Versammlungen und verschiedene Projekte beherbergt. Die fast 200 Beiträge, die daraufhin eingehen, können unter landartgenerator.org/LAGI-2020/ eingesehen werden, doch hier soll zumindest eines der vielen beeindruckenden Konzept vorgestellt werden.
Der von Nuru Karim und seinem Büro NUDES Architecture in Mumbai - die uns bereits im Januar mit dem People’s Tower begegnet sind - entworfene Solar Mountain, der verdientermaßen unter den Top Ten landet, besteht aus vier vorgefertigten modularen Einheiten mit einer Länge von jeweils 30 m, einer Breite von 5 - 30 m und einer maximalen Höhe von 14,5 m, die aus recyceltem Sperrholz gefertigt werden und interaktive Räume für Spiel und Erholung bieten, sowie Schutz vor der starken Sommersonne.
Den Namen hat der insgesamt 200 m lange Entwurf durch seine wellenförmige Form wie ein Gebirge - und seine vollständige Bedeckung der Südseite mit 728 PV-Paneelen, die über 300 MWh Strom pro Jahr erzeugen sollen.
Den ersten Platz des Wettbewerbs gewinnen übrigens die MIT-Designer Zhicheng Xu und Mengqi Moon He mit ihrem Projekt Lodgers (o. Lodgers: Serendipity in the Fly Ranch Wilderness), einem modularen, umweltfreundlichen Unterkunftssystem, das nachhaltige Hightech- und Lowtech-Strategien kombiniert und sich harmonisch in die lokale Wüstenlandschaft einfügt. Das autarke Design umfaßt u.a. Komposttoiletten, wiederverwendetes Holz und ein Strohdach aus lokalen Materialien.
Ein weiterer Wettbewerbsbeitrag trägt den Namen Ephemeral Station und stammt von einem Team des Londoner OF. Studio in Zusammenarbeit mit Studio 4215 und Alfredo Esteves Miramont. Gemeinsam wurde ein innovativer, autarker Unterstand mit möglichst geringen Auswirkungen auf die Umwelt entworfen - inspiriert vom Banyan-Baum, einer Baumart, die dichte, hängende Äste bildet, die überall dort Wurzeln schlagen, wo sie den Boden berühren.

(Grafik)
Historisch gesehen wurden Banyanbäume auch als Versammlungsorte genutzt, um Gemeinschaften zum Schutz vor den Elementen oder für gemeinsame Versammlungen zusammenzubringen. In diesem Sinne ist die Ephemeral Station für soziale Interaktion gedacht und dient als zentraler Ort für Aufführungen, Veranstaltungen, Sport, Festivals oder andere Zusammenkünfte, die Schatten, Schutz, Energie und Wasser benötigen.
Genau wie ein Banyanbaum nutzt die Skulptur, die sich an eine Vielzahl von Umgebungen anpassen kann, lange, schlanke Beine, um Oberflächenwasser oder Grundwasser in die Hauptstruktur zu pumpen. Anschließend wird das Wasser erhitzt und pasteurisiert, um es als Trinkwasser oder zur Bewässerung zu verwenden. Die Energieversorgung erfolgt durch PV-Paneele, die sich im Inneren der weitgehend transparenten Polycarbonat-Hülle befinden.
Der oberste Ballon der Skulptur hat einen besonderen Zweck, denn er dehnt sich aus und zieht sich zusammen, wenn sich die Innentemperatur ändert, fast wie ein lebender Organismus, der ein- und ausatmet. Damit dient er als direkter Indikator dafür, wie viel Energie eingefangen oder wie viel Wasser gefiltert werden muß. Dieser Teil paßt sich auch an die Menge an Schatten an, die er den darunter befindlichen Personen spenden muß.
Die gesamte Skulptur besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien, darunter Polycarbonat, Aluminium, Baumwollgewebe und Stahl. Während die Baumwolle, aus der der wolkenartige Ballon der Struktur besteht, alle zwei bis drei Jahre ausgetauscht werden muß, halten die PV-Paneele, die Hauptstahlstruktur und die Aluminiumelemente 20 - 30 Jahre. Anscheinend wird bereits 2021 in Gerlach, einem der Tore zum Burning Man Festival, ein Prototyp installiert, der wie ein außerirdischer Heißluftballon aussieht. Andere Quellen sprechen davon, daß dieser erst 2023 realisiert wurde. Belege dafür ließen sich bislang nicht finden, die veröffentlichten Abbildungen sind alle Renderings.
Die Designer Alessandra Boano und Jacopo Fasciolo vom Politecnico di Milano stellen im März 2021 das Design E-glamp vor, das sie als ein Produkt bzw. eine Dienstleistung für die wirtschaftliche und touristische Entwicklung in ländlichen Gebieten beschreiben, um dort Weingüter, Bauernhöfe und Bergstationen zu fördern. Man kann es sich wie ein kleines Haus im Stil von Airbnb vorstellen, das mit einem Fahrradnetzwerk wie Bird oder Lime verbunden ist.

(Grafik)
Bei E-glamp handelt es sich letztlich um ein integriertes System moderner Hütten, die alle unabhängig voneinander durch Solarzellen mit Strom versorgt werden und auch thermische Sonnenkollektoren besitzen. Zudem soll das Design in der Lage sein, Regenwasser für die Bedürfnisse der Gäste wiederzuverwenden.
Alle E-Glamp-Häuser sind modular, beweglich und aus nachhaltigen Materialien wie Holz gebaut. Sie sind außerdem mit intelligenter Technik ausgestattet, können Informationen sowie Energie mit der Umwelt auszutauschen und lassen sich vom Gast mit einer App verwalten. An ein E-Bike-System angeschlossen sind sie, um die klimaneutrale Erkundung der Landschaft zu fördern. E-glamp wird für die Green Concept Awards 2021 nominiert, gehört aber nicht zu den Gewinnern.
Im April 2021 stellen das New Yorker Architekturbüro Garrison
Architects und der Bauträger South End Development
LLC das „allererste Triple-Netto-Null-Projekt in den
Vereinigten Staaten“ vor, ein gemischter Wohn- und Geschäftkomplex
mit dem Namen Seventy-Six, der sich von der Adresse
des Baugrundstücks ableitet: 76 North Pearl Street. Triple-Netto-Null
bedeutet in diesem Fall, daß das Projekt darauf abzielt, 100 % des
Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen zu decken, 100 % des Abwassers
aufzubereiten und wiederzuverwenden und 100 % aller anfallenden Abfälle
zu recyceln oder zu kompostieren.

(Grafik)
Das preisgekrönte Design, das sich in einem frühen Stadium der Entwurfsplanung befindet, ist eines von 13 Projekten, die sich in der zweiten Runde des Anfang 2019 ausgeschriebenen Wettbewerbs Buildings of Excellence der New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) qualifiziert haben. Es wird mit dem NYSERDA Building of Excellence Award sowie mit dem Blue Ribbon Award for Design Excellence ausgezeichnet. Später folgt noch der Brooklyn AIA 2022 Excellence Award.
Das Projekt im Umfang von 250 Mio. $, das als Teil einer Wiederbelebungsmaßnahme des historischen Viertels South End in Albany, New York, entstehen soll, umfaßt vier Gebäude mit sieben bzw. neun Stockwerken, die mit im Werk vorgefertigten modularen Stahlrahmen errichtet werden, was Bauzeit und Ressourcenverbrauch reduziert. Der Schwerpunkt der Gebäude liegt auf der Schaffung von erschwinglichem Wohnraum und gleichzeitig einem gesunden und umweltfreundlichen Umfeld für die Bewohner. Zudem soll gezeigt werden, daß bewußtes Bauen regenerativ, kreativ, integriert und inspirierend sein kann.
Die geplanten 242 Wohneinheiten umfassen Studios, Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen sowie modulare Wohnungen, die für eine flexible oder alternative Nutzung umkonfiguriert werden können. 11 % der Gesamtfläche von 41.806 m2 sind für die gewerbliche Nutzung vorgesehen.

(Grafik)
Um den dreifachen Netto-Null-Status zu erreichen, verfügen die Gebäude über ein gemeinsames Energieerzeugungssystem, das den Einsatz von Erdwärmepumpen, Solarthermie, Lüftungssystemen mit Energierückgewinnung, PV-Dachmodulen mit Sonnennachführung, die in der Aufsicht wie die ISS aussehen, Solarfassaden, Batteriespeicher und Windturbinen umfaßt. Allerdings ist nicht klar, wo letztere installiert werden sollen und um welche Modelle es sich handelt.
Außerdem werden alle Wohnungen von Seventy-Six mit Induktionskochfeldern, Wärmepumpen-Wäschetrocknern und anderen energieeffizienten Geräten ausgestattet. Die Abwasser- und Regenwasserabflüsse werden wiederum durch Wasserauffang- und Filtertechnologien reduziert, während alle verbleibenden Abfälle entweder wiederverwendet, kompostiert oder vor Ort verbrannt werden. Darüber hinaus umfaßt das Projekt ein Modell der ,Living Machine’ für städtische Landwirtschaft mit vertikalen Gärten und Aquakulturbecken für Fische oder andere Wasserorganismen, die in das Wasserfiltersystem des Gebäudes integriert wird.
Zum Hintergrund: Das Konzept der Living Machine bedeutet Nachbildung natürlicher Kreisläufe zur Wasseraufbereitung und Nährstoffrückgewinnung in technischen Systemen, insbesondere für nachhaltige urbane Landwirtschaft. Es stammt von dem kanadischen Ökodesigner und Biologen John Todd, der das Prinzip schon in den 1970er Jahren entwickelte und später auch als Marke eintragen ließ. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Nancy Jack Todd hatte er bereits 1969 das berühmte New Alchemy Institute und 1981 die Organisation Ocean Arks International gegründet, um im Bereich ökologisches Design und Umweltinnovation zu arbeiten.
Auch der O-Tower der Bjarke Ingels Group (BIG) wird im April 2021 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei handelt es sich um die Pläne für das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum des chinesischen Elektronikunternehmens OPPO in Hangzhou, einem der größten Smartphone-Hersteller des Landes. Der Entwurf zeichnet sich durch eine geschwungene Form aus, die das Büro mit einer Unendlichkeitsschleife vergleicht und die das Tageslicht im Inneren maximiert und in der Mitte einen begrünten Innenhof mit Sitzbereichen schafft.

(Grafik)
Neben dem Innenhof und der symbolischen Bezugnahme auf das O in OPPO besteht die Idee hinter dem Entwurf des neuen Hauptquartiers darin, eine maximale Flexibilität der Innengrundrisse zu bieten. Die unteren Stockwerke werden öffentlich zugänglich sein und Platz für Ausstellungen, Konferenzen, eine Kantine und Werkstätten bieten, während die oberen Stockwerke primär für Büroflächen vorgesehen sind. Außerdem werden überall umfangreiche Grünflächen angelegt.
Durch das Absenken der südlichen Gebäudekante auf den Boden wird die Außenfläche der sonnenexponierten Fassade minimiert und gleichzeitig die Aussicht von der Innenfassade maximiert, die ihrerseits durch die Geometrie des Turms selbst vor Sonneneinstrahlung geschützt ist. Zudem wird die verglaste, adaptive Fassade mit Lamellen umhüllt, die sich nach der Sonne ausrichten, was den solaren Wärmeeintrag um 52 % reduzieren und den Energiebedarf für die Kühlung senken soll.
Der O-Tower, über dessen voraussichtliche Höhe noch nichts bekannt ist, entsteht in Hangzhous Future Sci-Tech City, einem Komplex für globales Technologieunternehmertum, der sich durch eine besondere Umgebung auszeichnet, zu der ein natürlicher See, ein 10.000 m2 großer Park sowie ein pulsierendes Stadtzentrum gehören. Der Baubeginn erfolgt zwar im September 2021, wird aber wegen einer ,Anpassungen der Pläne’ und weiteren Herausforderungen gestoppt oder verzögert. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme wird derzeit nicht vor 2027 erwartet.
Mitte April 2021 werden auch die Gewinner des A’ Design Award 2020-2021 bekanntgegeben, dem weltweit größten Designwettbewerb, der die besten Entwürfe vom Konzept über den Prototyp bis hin zum fertigen Produkt auszeichnet. Zu den Top 20 gehören beispielsweise das bereits realisierte, 500 m2 große Hi Sea Floating Hotel von Xinmeng Dong, das seit dem Vorjahr vor der Insel Dongshan in Fujian liegt, 500 m vom Strand entfernt. Mehr über derartige Konstruktionen findet sich im Kapitelteil Maritime Habitate.

(Grafik)
Unter den Entwürfen ist besonders das Projekt The Noom Housing von Sanzpont Arquitectura mit Hauptsitzen in Barcelona, Cancún, Chicago und Santo Domingo sowie dem spanischen Büro Pedrajo Mas Pedrajo Arquitectos erwähnenswert - eine ungewöhnlich schöne, organische Struktur, bedeckt mit üppigen Grün, das durch die vertikalen Wälder entlang der Außenfassade entsteht, und fast vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben.
Das noch mit elf weiteren Architekturpreisen ausgezeichnete Projekt konzentriert sich auf die Schaffung einer Gemeinschaft für Menschen, die auf drei Säulen basiert: Wellness, Nachhaltigkeit und Flexibilität. Noom bietet den Bewohnern daher nicht nur ein besonderes Zuhause, sondern auch Annehmlichkeiten wie Grünflächen, Pools, Workshop-Zentren für Kunst, Erholungszentren und Meditationsbereiche. Darüber hinaus sind 70 % der Projektfläche von Natur bedeckt - ganz abgesehen von den vertikalen Wäldern, die die in das Haus eindringende Luft filtern und dazu beitragen, die Temperatur in den Häusern zu senken.
Die geplante Wohnanlage in Cancún, Mexiko, besteht aus drei Gebäuden mit abgerundeter Dreiecksform und jeweils fünf Stockwerken, wobei die Wohnungen auf jeder Etage 60 bzw. 120 m2 groß sind und jeweils über ein, zwei oder drei Schlafzimmer verfügen. Der einzigartige Grundriß ermöglicht es jedem Zimmer, Zugang zu reichlich indirektem Sonnenlicht zu haben, wobei das Design auch die natürliche Belüftung fördert.
Die Struktur gipfelt in einer Terrasse im fünften Stock, mit einem Garten, in dem die Bewohner ihre eigenen Lebensmittel anbauen können, sowie mit einem Schattendach, das mit Solarpaneelen belegt zur Energiegewinnung beträgt. Zusammen mit einem hocheffizienten LED-Lichtsystem soll sich der Energieverbrauch von Beleuchtung und Klimatisierung damit um bis zu 85 % senken lassen. Das Projekt umfaßt zudem bioklimatische und nachhaltige Strategien wie Regenwassernutzung, Abwassertrennung, Feuchtgebiete für die Grauwasseraufbereitung, Biokläranlagen und Kompostiersysteme.
Laut offiziellen Angaben ist das Wohnprojekt seit spätestens Mai 2022 im Bau und die Fertigstellung wurde ursprünglich für das Jahr 2023 erwartet, es gibt jedoch auch Mitte 2025 noch keine Hinweise darauf, daß das Projekt inzwischen vollendet worden ist.
Nachdem im Stadtteil Lakhta von Sankt Petersburg, Russland, zwischen 2012 und 2018 das von Tony Kettle und dem britischem Architekturbüro RMJM entworfene erste Lakhta Center gebaut worden war, den mit 462 m Höhe höchsten Wolkenkratzer in Russland und Europa und Hauptsitz des Energiekonzerns Gazprom, der äußerlich durch seine sich verdrehende Glasfassade auffällt - die Doppelwandfassade reduziert Wärmeverluste und trägt zur Minimierung des Energiebedarfs für Heizung und Kühlung bei - und der im Inneren mit regenerativen Doppelstockaufzügen ausgestattet ist, durch die das Center bis zu 25 % Energie einsparen kann, werden im Mai 2021 die Pläne für das Lakhta Center II bekanntgegeben.

(Grafik)
Das schottische Architekturbüro Kettle Collective verkündet die Absicht, in Sankt Petersburg in der Nähe des bestehenden einen neuen Wolkenkratzer mit 703 m Höhe zu errichten, der nach seiner Fertigstellung das zweithöchste Gebäude der Welt sein soll. Es würde aus 150 Stockwerken bestehen, wobei die oberste Etage etwa in 590 m Höhe liegt und damit die höchste bewohnte Etage und der höchste Aussichtspunkt der Welt wäre. Das Innere des Turms würde Büroflächen, Wohnbereiche, dreifach hohe Atrien und Grünflächen umfassen, wobei auch in diesem Gebäude mehrgliedrige regenerative Aufzüge zum Einsatz kommen sollen.
Das Gebäude mit seiner gewundenen Form und die turmartigen Spitze sind eine Reminiszenz an die berühmten Kirchtürme von Sankt Petersburg, und das Design ist sowohl ästhetisch als auch funktional, da es die beträchtlichen Windkräfte, die auf die Struktur einwirken, reduziert, was wiederum zu einer Verringerung der Größe der erforderlichen Strukturelemente innerhalb des Gebäudes führt.
Tony Kettle beschreibt das neue Lakhta Center mit zitierwürdigen Worten: „Der Turm entstand aus einer kühnen Idee, die von Energie in all ihren Formen inspiriert wurde, von spiralförmigen Wellen, die um Quasare im Weltraum entstehen, bis hin zu den Spiralen der Wellenenergie. Die äußere Schicht des Gebäudes besteht aus spiralförmigen Säulen, die ein offenes, organisches, schraubenförmiges Diagramm bilden, während die Struktur von einer Reihe spiralförmiger Atrien durchbrochen wird, die mit vertikalen öffentlichen Räumen verbunden sind.“
Das Projekt soll zudem das beste Niedrigenergiedesign seiner Klasse haben und neben vertikalen, urbanen Grünflächen eine hochmoderne Glasfassade mit Sonnenschutz und Wärmedämmung aufweisen, um Wärmeverluste zu minimieren und den Energiebedarf für die Klimatisierung zu senken. Konkrete Details zur direkten Nutzung von Energien wie Solar- oder Windkraft wurden bisher nicht veröffentlicht.
Im Dezember 2021 werden weitere Pläne für ein Lakhta Centre III bekannt gegeben, das 555 m hoch werden soll. Ab 2023 wird auf dem geplanten Baugelände des Lakhta Centre II ein kleiner Yachtclub abgerissen und erwartet, daß der Bau nun im Jahr 2024 beginnt, mit einer geplanten Fertigstellung 2030. Dies läßt sich bislang aber nicht bestätigen - und auf der Homepage von Kettle Collective werden die Projekte inzwischen überhaupt nicht mehr aufgeführt.

(Grafik)
Ebenfalls im Mai 2021 wird von der Bjarke Ingels Group (BIG) offiziell das überarbeitete und endgültige Design des Västerås Travel Center in Schweden vorgestellt, dessen Vorstudie erstmals 2015 veröffentlicht worden war. Der neue Verkehrsknotenpunkt soll einen besseren Zugang zu den Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs in der Stadt ermöglichen. Das Hauptgebäude ist von Terrassen umgeben, die eine Verbindung zu den Parks Vasaparken und Hamnparken herstellen, sowie von Treffpunkten, Aussichtspunkten, WLAN-Zonen und Sitzgelegenheiten.
Das Design umfaßt mehrere andere Nachhaltigkeitsmerkmale, darunter eine langgezogene, gebogene Glasfassade, die für viel Tageslicht und eine offene Atmosphäre sorgt, während sie Wärmeverluste minimiert; die mit einem markanten Zickzack-Schnitt gestaltete Decke, die ebenfalls Tageslicht einläßt und die natürliche Lüftung fördert; sowie die Wiederaufbereitung von Regenwasser. Die Beheizung erfolgt über Fußbodenheizung, zudem ist der Einsatz von Fußbodenkühlung und Regenwassernutzung zur Klimaregulierung vorgesehen.
Elementar ist das ,schwebende’ Dach, in dessen gesamte Fläche PV-Module integriert sind, die bis zu 70 % des gesamten Energiebedarfs des Gebäudes decken sollen. Der Bau beginnt im Jahr 2022 und die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen.
Auch das Wohngewächshaus-Projekt von Delugan Meissl Associated Architects (DMAA) auf der Überseeinsel in Bremen wird im Mai 2021 erstmals öffentlich vorgestellt, nachdem die Planungen bereits im Vorjahr begonnen hatten. Die Überseeinsel ist ein neues, modernes Stadtquartier von rund 15 Hektar, das auf dem Gelände des 2017 geschlossenen Kellogg’s-Werks zwischen Europahafen und Weser entsteht und Teil des Entwicklungsgebiets in der Überseestadt ist. Ab 2019 wird das Gelände von der Überseeinsel GmbH in Zusammenarbeit mit der Stadt Bremen neu entwickelt, um Arbeits-, Wohn-, Bildungs- und Freizeitgebiete zu umfassen.

(Grafik)
Der Entwurf von DMAA mit dem Namen Residential Greenhouse zeichnet sich durch eine besondere dreiteiliger Architektur aus: Der Kern des Gebäudes ist ein vollständig vorgefertigter Wohnblock in modularer Holzbauweise, der vor Ort nur noch montiert wird; auf dem Dach befindet sich ein großes Gewächshaus, das sowohl dem Urban Farming durch die Bewohner dient als auch dem kommerziellen Gemüseanbau; und eine großzügige Laubengangstruktur aus Stahl und Betonbodenplatten erschließt die Wohnungen und schafft halböffentliche Freiräume. Zudem haben die Mieter Zugang zu Gemeinschaftsbalkonen und anderen Freiflächen, auf denen sie ebenfalls Pflanzen anbauen können.
Das 27,5 m hohe Gebäude mit einer Wohnfläche von 5.065 m2, das als Vorzeigeprojekt für nachhaltigen, sozialen und urbanen Wohnungsbau propagiert wird, besitzt sieben oberirdische Geschosse plus Souterrain, wobei je nach Modul-Kombination 30 - 54 Wohneinheiten möglich sind, je nachdem, wie viele Studio-, Zweizimmer-, Dreizimmer- und Dreizimmer-plus-Büro-Kombinationen für das endgültige Layout ausgewählt werden.
Das Projekt Residential Greenhouse weist auch zahlreiche energiesparende Elemente auf. So wird eine Wandplatte im Kern des Gebäudes beheizt, und diese Wärme strahlt in die Räume ab. Die aufsteigende Wärme beheizt dann das darüber liegende Gewächshaus auf natürliche und effiziente Weise, ohne daß zusätzliche Energie benötigt wird. Dieses System ermöglicht einen ganzjährigen Gartenanbau und macht nachhaltige Lebensmittel zu einer bequemen Option, selbst in einem Gebäude mit mehreren Wohneinheiten.
Der erste Spatenstich sollte noch in diesem Jahr erfolgen, die Fertigstellung war für 2025 geplant. Tatsächlich befindet sich das Projekt zu diesem Zeitpunkt aber weiterhin in der Planungs- und Vorbereitungsphase und der Bau hat noch immer nicht begonnen.
Sehr
ambitioniert wirkt das für Paris gedachte Projekt Crescent
Moon (o. Garden City of the Crescent Moon) des lokalen
Architekturbüros RESCUBIKA Creations, das im August 2021 in
den Fachblogs erscheint. Das Büro ist uns im Vorjahr mit dem für
New York City geplanten grünen Mandragore-Tower begegnet.

(Grafik)
Der Entwurf für das 12. Arrondissement von Paris konzentriert sich auf den Bois de Vincennes, den größten öffentlichen Stadtwald der Metropole, in dem auch der Lac des Minimes liegt, ein künstlicher See, der an der Stelle des ehemaligen Minimes-Klosters angelegt wurde, von dem er seinen Namen hat. Die markante Silhouette des Gesamtprojekts ist der Form von Canyons nachempfunden und folgt der natürlichen Biegung des Sees und seiner Inseln.
Die auf eine grünere, gesündere Zukunft ausgerichtete Gartenstadt integriert die urbane Landwirtschaft als einen wichtigen Teil des Entwurfs, bei der alle Höfe, Dächer und öffentlichen Flächen für den Anbau und die Viehzucht genutzt werden. Dachterrassen und kleine städtische Gewächshäuser schaffen Anbauflächen für Kräuter, Gewürze und Gemüse, und sogar Viehzucht- und Milchproduktionsbereiche werden sich mitten in der Stadt befinden, in der natürlich auch Flächen für Wohnungen, Büros, Sportanlagen und Bereiche für kulturelle Aktivitäten vorgesehen sind.
Zwar werden in den verfügbaren Quellen keine spezifischen Technologien wie Photovoltaik oder Windkraft genannt, doch die Entwürfe betonen die Integration nachhaltiger Systeme, darunter auch Energiestrategien, die auf erneuerbaren Quellen basieren, um eine umweltfreundliche und gesunde urbane Umgebung zu schaffen. Auf den Renderings sind mehrere Senkrechtachser zu sehen, die energetisch aber kaum mehr als ,Windspiele’ sind. Größere Dach- und Fassadenflächen scheinen photovoltaisch zu sein, nähere Angaben darüber gibt es bislang aber nicht.
Ende August 2021 stellt das italienische Architekturbüro Carlo Ratti Associati (CRA) erstmals den Entwurf eines visionären 218 m hohen Wolkenkratzers vor, der als weltweit erstes Hochhaus in seiner Fassade eine großflächige vertikale Farm besitzt. Das Projekt entstand als Beitrag für einen internationalen Architekturwettbewerb, der von der chinesischen Supermarktkette Wumart ausgelobt wurde. Für die vertikale Farmtechnik arbeitete CRA mit dem italienischen Unternehmen ZERO zusammen.

(Grafik)
Der 51-stöckige Jian Mu Tower, der auch als ,Farmscraper’ bezeichnet wird, soll in Shenzhen entstehen und einen Meilenstein für urbane Landwirtschaft und nachhaltige Hochhausarchitektur bilden, indem er zeigt, wie Lebensmittelproduktion, Architektur und Technologie in Megastädten der Zukunft verschmelzen können, um Ernährungssicherheit, kurze Lieferwege und Klimaschutz zu verbinden. Die Form des Turms ist von der chinesischen Mythologie inspiriert: Die rechteckige Basis steht für die Erde, die runde Spitze für den Himmel – in Anlehnung an den Jian Mu-Baum, der Himmel und Erde verbindet.
Die Fassade des Gebäudes von rund 10.000 m2 dient dem hydroponischen Anbau, bei dem Gemüse, Früchte und Kräuter ohne Erde, nur mit Nährstofflösungen, kultiviert werden, überwacht von einem KI-gestützten ,virtuellen Agronomen’, der Bewässerung, Nährstoffversorgung und Klima steuert. Die durch ein nachhaltiges Bewässerungssystem versorgte Vertikalfarm, die die hohe Niederschlagsmenge in Shenzhen nutzt, ist darauf ausgelegt, jährlich etwa 270.000 kg Nahrungsmittel zu produzieren – genug, um bis zu 40.000 Menschen zu versorgen - wobei Anbau, Ernte, Verkauf und Konsum der Produkte komplett im Gebäude stattfinden.
Die vertikale Begrünung dient aber nicht nur der Lebensmittelproduktion, sondern auch als Sonnenschutz und zur Verbesserung des Mikroklimas innerhalb des Hochhauses, das Büro- und Einzelhandelsflächen sowie einen Supermarkt und öffentlich zugängliche Gärten umfaßt, denn die Pflanzen reduzieren den Energiebedarf für die Kühlung, indem sie die direkte Sonneneinstrahlung auf die Gebäudehülle mindern. Ein konkreter Termin für den Baubeginn oder die Fertigstellung werden bislang nicht genannt.
Anläßlich der 26. UN-Klimakonferenz (COP26) im Oktober und November 2021 in Glasgow präsentiert das Architekturbüro Skidmore, Owings & Merrill (SOM) den Vorschlag eines Wolkenkratzers, der nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv sein wird. Dies bedeutet, daß er mehr CO2 aus der Atmosphäre aufnimmt, als er verursacht. Um dies zu erreichen, würde die Gebäudehülle des Urban Sequoia über eine integrierte CO2-Abscheidungstechnologie verfügen, wie sie mit heutigen Technologien bereits realisierbar ist.

(Grafik)
Der Wolkenkratzer soll ein attraktives Design mit Verglasung und Begrünung aufweisen und aus umweltfreundlichen Materialien, nachwachsenden Rohstoffen und innovativen Baustoffen errichtet werden, wie Hanfbeton, Hanfkalk, Biozement und Holz. Integrierter Biomasse und Algen verwandeln die Fassaden des Gebäudes in eine Biokraftstoffquelle, die Heizungssysteme, Autos u.a. antreibt, sowie in eine Bioproteinquelle, die in vielen Branchen genutzt werden kann.
Die technischen Details sind in diesem frühen Konzeptstadium noch sehr spärlich, aber nach Angaben von SOM würde der Wolkenkratzer bis zu 1.000 Tonnen Kohlenstoff pro Jahr binden, was 48.500 Bäumen entsprechen würde. Der abgeschiedene Kohlenstoff soll für verschiedene industrielle Anwendungen genutzt werden. Das Architekturbüro spricht von ganzen ,Wäldern’ aus Urban Sequoia-Gebäuden, die die Städte verändern, die Luft in der unmittelbaren Umgebung reinigen und gemeinsam eine neue, kohlenstoffnegative Stadtkultur schaffe könnten.
Das Konzept wird für die COP27 in Ägypten als Urban Sequoia NOW weiterentwickelt, wobei nun auch von einer Energieerzeugung durch Solarglas gesprochen wird. Eine konkrete Umsetzung oder ein im Bau befindliches Urban Sequoia-Gebäude kann bislang aber nicht bestätigt werden.
Noch etwas zur COP26: Hier wird im Rahmen der Aktivitäten des Bündnisses
,Ummah for Earth’ auch eine neue Initiative angekündigt, mit
der eine Gruppe muslimischer Umweltschützer aus einigen Nichtregierungsorganisationen
dabei helfen wollen, daß zehn berühmte Moscheen auf der ganzen Welt
grün werden. Als Beispiele nennt die Initiative ,Grüne Moscheen’
die Glasgow Central Moschee in Schottland, die zu
diesem Zeitpunkt 130 Solarpaneele auf das Dach installiert bekommt,
sowie die Istiqlal-Moschee in Jakarta, Indonesien,
die schon 2019 teilweise auf Solarenergie umgestiegen ist - mittels
143 Paneelen.
Die Initiative stützt sich auf einen detaillierten technischen Bericht, der von einem Team der American University of Beirut in Zusammenarbeit mit der Lebanese Foundation for Renewable Energy und dem National Council for Scientific Research erstellt wurde. In dem Bericht werden die potentiellen Kohlenstoffeinsparungen sowie die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen durch die Installation von Solarsystemen an zehn wichtigen Standorten auf der ganzen Welt analysiert. Demnach würde die Installation der vorgeschlagenen Solaranlagen insgesamt etwa 22,3 GWh Strom pro Jahr erzeugen.
Zu den ausgewählten Moscheen gehören u.a. die Al-Azhar-Moschee in Kairo, die großen Moscheen von Mekka und Medina, Gebetshäuser in Indonesien und Südafrika - sowie die Umayyaden-Moschee in Damaskus. Bislang wurde davon allerdings noch nichts umgesetzt, einzig in Marokko verzeichnet die Initiative einigen Erfolg, wo im Laufe der Zeit die Energiekosten von über 100 Moscheen durch den Einbau energieeffizienter LED-Beleuchtung und Solarkollektoren für Warmwasser um über 40 % gesenkt werden können.
Zur Erinnerung: In Deutschland haben Studentinnen und Studenten der Technischen Universität Darmstadt bereits im Jahr 2010 begonnen, Beratungsleistungen für Solarstromanlagen anzubieten, was dazu führte, daß bis 2012 die Emir-Sultan-Moschee in Darmstadt und die Mevlana-Moschee in Weinheim mit Solarstromanlagen ausgestattet wurden.
Ebenfalls im November 2021 werden die Gewinner des Golden Pin Concept Design Award 2021 präsentiert, zu denen auch das Konzept Photosynthesis Protective Shell von Chsiao-Yu Sun und Chien-Hsun Chen gehört, das speziell für den Schuster Park in Queensland, Australien, entwickelt wurde mit dem Ziel, Menschen im öffentlichen Raum vor starker UV-Strahlung zu schützen, die in dieser Region besonders hoch ist. Dabei funktioniert die Struktur wie eine bionische Blume, die sich bei starker UV-Strahlung entfaltet, während sie sich bei schwacher Strahlung oder nachts zusammenzieht.

Protective Shell
(Grafik)
Das visionäre Schutzsystem für öffentliche Räume, das Funktionalität mit ästhetischer Wirkung verbindet, absorbiert tagsüber mit Hilfe von biotechnologischen und architektonischen Innovationen UV-Strahlen, während es nachts leuchtet. Hierzu besteht die Hülle des Pavillons aus Faseroptik-Röhren, die mit grünem Fluoreszenzprotein gefüllt sind, das UV-Strahlen absorbieren und das gespeicherte Licht nachts als sanftes Leuchten wieder abgeben kann.
Zusätzlich kann die absorbierte UV-Energie in kinetische Energie umgewandelt werden, um das Öffnen und Schließen der Module zu steuern. Dies ist auf zwei Wegen denkbar: über eine direkte mechanische Reaktion mittels Materialien, die sich unter UV-Licht direkt mechanisch verformen und so Bewegung erzeugen können, oder mittels einer photoelektrischen Umwandlung durch photoelektrochemische Zellen, wobei die elektrische Energie dann kleine Motoren oder Aktuatoren antreiben kann.
Eine genaue technische Ausführung ist in den Konzeptbeschreibungen bislang nicht näher ausgeführt. Mehr über solche Technologien findet sich unter Licht, UV, Infrarot und Laser im Kapitel Micro Energy Harvesting.
Die oben bereits erwähnte Bjarke Ingels Group (BIG) präsentiert gemeinsam mit Inflow, Pantograph, BuroHappold und ARUP im November 2021 die finalen Pläne für den AI tech ESET Campus in Bratislava, Slowakei, dessen ursprüngliches Konzept bereits im August 2017 als Siegerentwurf eines weltweiten Designwettbewerbs vorgestellt worden war. Der Campus, der auf dem Gelände eines ehemaligen Militärkrankenhauses entstehen und rund 55.000 m2 umfassen wird, soll der neue Hauptsitz des europäischen IT-Sicherheitsunternehmens ESET samt einem Forschungszentrum für Cybersicherheit und KI beherbergen. 2019 wurde BIG dann beauftragt, den Entwurf zu verwirklichen.

(Grafik)
Das in das bestehende Waldparkgebiet integrierte Konzept setzt auf Nachhaltigkeit, Funktionalität und Ökologie und bietet in seinen zwölf Gebäuden, die um einen zentralen Innenhof angeordnet sind, moderne Büroflächen, Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen, Wohnungen für internationale Mitarbeiter und Studierende, ein Auditorium, Sportanlagen, Gesundheits- und Fitneßcenter sowie zahlreiche öffentliche und halböffentliche Räume und begrünte Flächen. Zudem setzt der ESET Campus auf eine vollständig elektrische Energieversorgung.
Hierzu sind die Gebäude mit wellenförmigen Solardächern ausgestattet, die nicht nur das architektonische Erscheinungsbild prägen, sondern auch einen wesentlichen Teil des Energiebedarfs durch Photovoltaik decken sollen. Diese Solardächer verbinden die einzelnen Pavillons optisch und funktional, genauere technische Daten sind bislang aber nicht bekannt. Es soll auch Erdwärmepumpen geben.
Der erste Spatenstich ist für das Jahr 2024 geplant, doch das Projekt wird erst Ende Mai 2025 von der Stadtverwaltung endgültig genehmigt. Nun sind die Fertigstellung und Eröffnung für 2027 vorgesehen.
Zu den Konzepten, die im Dezember 2021 veröffentlicht werden, gehört das Öko-Resort Qanat Hotel, das für einem Küstenstreifen der Halbwüste im Südosten des Iran geplant ist. Es befindet sich in der Nähe eines bestehenden Qanats - sprachlich verwandt mit Kanal -, einem alten unterirdischen Bewässerungssystem, das Namensgeber und Grundlage für das gesamte Design des Gebäudes bildet.
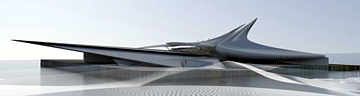
(Grafik)
Bei dem Entwurf von Margot Krasojević Architects - einem Büro, das in den bisherigen Jahresübersichten schon mehrfach mit innovativen Designs aufgetreten ist - wird das Wasser unter dem Hotel fließen und so für eine natürliche Kühlung in der Wüstenhitze sorgen, ohne die typische Verdunstung, die an der Oberfläche auftritt. Außerdem wird das Wasser zur Bewässerung genutzt, ohne daß Pumpen erforderlich sind. Das Design nutzt das Wasser auch für Innenpools und Springbrunnen.
Über dem Atrium-Pool des Hotels ist als Schutz vor der intensiven Sonne ein großes Vordach aufgehängt, das flexibel ist, um sich im Wüstenwind zu bewegen, aber auch stabil genug, um Kondenswasser zu sammeln, das in den darunter liegenden Atrium-Pool fließt. Gleichzeitig soll das an traditionelle Nomadenzelte anknüpfende Vordach photovoltaisch sein und die Solarstrahlung in nutzbare Energie umwandeln.
Türme aus Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff sammeln die warme Luft und leiten sie in das Erdgeschoß des Hotels, wo sie durch Verdunstungskühlung auf eine für die Gäste angenehme Temperatur gebracht wird. Die Hotelzimmer sind teilweise in den Boden eingegraben, um über das darunter liegende Qanat kühlere Temperaturen zu erhalten, und ein durchbrochenes Dach läßt natürliches Licht eindringen.
Kommen wir nun zu einigen der tatsächlich umgesetzten Projekte, die in diesem Jahr gemeldet werden, angefangen mit den Bauten der Solar Decathlon-Wettbewerbe.
Nachdem im April des vergangenen Jahres die 2. U.S. Solar Decathlon Challenge mit 48 teilnehmenden Teams aufgrund der Corona-Panik nur virtuell stattgefunden hat, mit der University of Oregon und der Miami University als die siegreichen Teams, werden im April 2021 die Gewinner der ebenfalls virtuellen 9. U.S. Solar Decathlon Build Challenge bekanntgegeben, an der neun Teams teilnehmen, mit dem Team der University of Clorado Boulder als Sieger.
Zeitgleich läuft die 3. U.S. Solar Decathlon Design Challenge, an der diesmal 63 Teams aus zwölf Ländern teilnehmen, um widerstandsfähige und leistungsstarke Wohnhäuser, Schulen, Büros und Einzelhandelsflächen zu entwerfen, welche mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Neun von ihnen werden gebaut und im allerersten ,Solar Decathlon Virtual Village’ präsentiert. Die siegreichen Teams sind die der University of Oregon auf dem ersten und der Northwestern University auf dem zweiten Platz.

Im Mai findet der 1. Solar Decathlon India statt, mit 24 Teams und virtuell; im September und Oktober der 3. Solar Decathlon China mit 15 Teams; und im November der 3. Solar Decathlon Middle East in Dubai mit acht Teams. Hier ist der Gewinner das Team SCUT x CSCEC (South China University of Technology gemeinsam mit China State Construction Engineering Corporation) mit ihrem energieautarken Solarhaus namens X-House.
Parallel dazu wird der Solar Decathlon Europe 21 (SDE21) erstmals in Wuppertal, Deutschland, ausgetragen, mit dem Fokus auf urbane Nachverdichtung, Sanierung und Weiterbau des Gebäudebestands. Für den Wettbewerb qualifizierten sich 18 Hochschulteams aus elf Ländern, die auf dem Solar Campus im Mirker Quartier in Wuppertal ihre voll funktionsfähigen, nachhaltigen Gebäude errichten.
Aufgrund der Corona-Panik wird das Finale mit der Event- und Ausstellungsphase allerdings auf den Juni 2022 verschoben. Gesamtsieger wird das Team RoofKIT vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit einem Prototyp für nachhaltige, urbane Nachverdichtung, der als Aufstockung auf ein bestehendes Gebäude konzipiert ist. Er besteht aus vier vorgefertigten Modulen mit einem zentralen Kern, in dem alle technischen Installationen sowie Küche und Bad untergebracht sind. Dadurch bleibt fast die gesamte Wohnfläche von 54 m2 flexibel nutzbar für Wohnen, Arbeiten und Schlafen.
Die Energieversorgung basiert auf Photovoltaik-Thermie-Kollektoren (PVT), die sowohl Strom als auch Wärme liefern. Diese dienen als Wärmequelle für eine Sole-Wasser-Wärmepumpe, die für Heizung und Warmwasser sorgt. Um Energieerzeugung und -verbrauch zeitlich zu entkoppeln und die Eigenversorgung zu optimieren, sind sowohl thermische als auch elektrische Speicher integriert. Nach dem Wettbewerb wird der Prototyp nach Karlsruhe transportiert und dient dort als Gästehaus und Anschauungsobjekt auf dem KIT-Campus.
Ebenfalls im April 2021 beginnt die Pre-Order-Phase für Cabin ANNA, einem vielseitigen Haus, dessen Rahmen sich auf geführten Tragschienen dem Wetter anpassen läßt. Die Entwicklung von Cabin Anna begann im Jahr 2016, als der niederländische Physiker Caspar Anne Schols in Eindhoven für seine Mutter ein Gartenhaus als flexiblen Rückzugsort im Hinterhof entwarf und baute. Die öffentliche Aufmerksamkeit für das Garden House führt zu einer Reihe von Preisnominierungen und einem Stipendium an der Architectural Association in London, wo Schols bis 2019 ein Architekturstudium absolviert.
In dieser Zeit wird das Konzept weiterentwickelt, da sich Schols ein verkaufbares, voll bewohnbares Haus als Flatpack vorstellt, das als bewegliche, multifunktionale Holzkonstruktion überall auf der Welt auf- und umgebaut werden kann. Das Besondere dabei ist, daß zwei oder vier verschiebbare Hüllen – eine innere aus Holz und Glas, eine äußere nur aus Holz – es erlauben, das Haus je nach Wetter, Stimmung oder Anlaß zu öffnen oder zu schließen.
Das Konzept wird unter dem Namen Cabin Anna im Jahr 2020 erstmals einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert, als in Holenberg am Rande des Naturschutzgebietes De Maashorst, ein Prototyp entsteht, der Interessierten auch als Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung steht. Neben zahlreichen weiteren Auszeichnungen gewinnt Cabin Anna auch den Architizer A+ Project of the Year Award 2021.
Als einzelne Einheit erscheint Cabin Anna wie eine traditionelle Holzhütte im Wald. Sie besteht aus einem strukturellen Rahmen, dessen Außenwände aus zwei separaten ,Schalen’ gefertigt sind, wobei die Innenwand aus einem Gerüst aus Holz und Glas von der überdachten Außenwand aus Holz getrennt ist. Die Schalen lassen sich auf Stützschienen verschieben, so daß die Kabine je nach Stimmung, Anlaß oder Wetterbedingungen unterschiedlich konfiguriert werden kann.

(Detail)
Wenn das Wetter unter den Gefrierpunkt sinkt und der Wind weht, bildet Cabin Anna eine geschlossene Einheit, die vor der Kälte schützt. Sobald die kalte Nacht vorbei ist und die Morgensonne aufgeht, können die Holzbalken aus dem Glasrahmen der Hütte herausgezogen werden, um einen transparenten Wohnraum in der Mitte oder auf der rechten Seite der Hütte zu schaffen, der als eine Art Sonnenraum fungiert. In den wärmeren Monaten kann der innerste Glasrahmen der Kabine weggeschoben werden, um einen komplett freiliegenden Mittelraum zum Sonnenbaden, Schlafen im Freien oder zur allgemeinen Entspannung zu schaffen.
Die Hütte mit einer Bodenfläche von 34 - 57 m2, davon ca. 8 m2 als Giebelzimmer im Obergeschoß, einer Höhe von 4,5 m und einem Gewicht von ca. 22 Tonnen bietet Platz für zwei Betten, eine komplette Küche, eine Toilette, eine Dusche und sogar eine versenkte Badewanne, und kann für ein netzunabhängiges Leben mit einem feuerbeheizten Kessel, einem Wasseraufbereitungssystem und einem Solarstromnetz ausgestattet werden.
Mit der kommerziellen Markteinführung werden 2021 die beiden Varianten ANNA Stay (für Wohnen und Übernachten) und ANNA Meet (für Meetings, Kurse oder Veranstaltungen) zur Vorbestellung bei Preisen ab 547,000 € angeboten. Laut Schols soll allerdings nur eine begrenzte Anzahl von 365 ANNAs produziert werden - gemäß der Anzahl der Tage, die die Erde braucht, um die Sonne einmal zu umrunden.
Zur Erinnerung: Die von Schols umgesetzte Technologie ist nicht neu, denn Ross Russell und Sally Morris hatten gemeinsam mit dem Londoner Architekturbüro dRMM bereits im Oktober 2009 in Suffolk, England, das Sliding House fertiggestellt, das über eine gleitende, äußere Struktur verfügt, die das Haupthaus, ein Nebengebäude für Gäste, eine Garage sowie ein Gewächshaus je nach Bedürfnis oder Klimageschehen ganz oder teilweise abdecken kann.
Nach
dem Erfolg der Bosco Verticale genannten Türme
von Stefano Boeri Architetti, die im Oktober 2014 im
Norden von Mailand fertiggestellt wurden, schlagen ähnliche Gebäude
nun weltweit Wurzeln.

Vertical Forest
Bereits 2016 begann der Bau des Hochhausensembles Nanjing Vertical Forest (o. Nanjing Green Towers) in Jiangsu, dessen Fertigstellung 2018 erfolgte, obwohl sich die Bepflanzung mit 600 großen Bäumen, 200 mittelgroßen Bäumen und über 2.500 Sträuchern und Hängepflanzen sowie die letzten Arbeiten noch bis in das Jahr 2020 hinzogen.
Die offizielle Eröffnung und Inbetriebnahme der beiden 108 m bzw. 200 m hohen ersten Vertical-Forest-Türme in Asien, zwischen denen Büroflächen, ein Hotel, eine grüne Architekturschule, Einzelhandelsflächen, Restaurants, ein Konferenzsaal und Ausstellungsräume vorgesehen sind, wird schließlich für den Mai 2021 angesetzt, läßt sich bislang aber nicht bestätigen.
In China sind noch weitere Projekte unter der Leitung des chinesischen Teams von Boeri in Arbeit. Eines, das seit 2017 im Bau ist, trägt den Namen Easyhome Huanggang Vertical Forest City Complex und erstreckt sich über eine Fläche von 4,54 Hektar in der Nähe von Wuhan. Es umfaßt insgesamt fünf Türme, von denen zwei begrünt sein und Wohnungen beherbergen werden, während die übrigen als Hotels und Geschäftsräume konzipiert sind.

(Grafik)
Die Hauptbauarbeiten werden im Dezember 2021 abgeschlossen, nachdem 395 (andere Quellen: 404) Bäume, 3.600 Sträucher und 12.000 Stauden gepflanzt worden sind. Die ersten Bewohner ziehen im folgenden Frühjahr ein. Die offizielle Eröffnung und vollständige Inbetriebnahme erfolgt dann im Mai 2022.
Das Architekturbüro hat darüber hinaus noch mehrere weitere begrünte Gebäude in China geplant, darunter das Rehabilitation Center Shenzhen, das bis 2023 fertig werden soll, sowie die gigantische Liuzhou Forest City für rund 30.000 Bewohner, deren Parks, Gärten und Gebäudefassaden mit 40.000 Bäumen und fast einer Million Pflanzen aus mehr als 100 Arten bepflanzt werden soll. Auch hier begannen die Bauarbeiten im Jahr 2017 und sollten bereits 2020 beendet werden, doch auch Mitte 2025 wird das Projekt weiterhin als ,in Umsetzung’ beschrieben.

aus LEGO
Inzwischen gibt es sogar eine LEGO-Version von TheCasleFan, der eine Mini-Nachbildung von Boeris Mailänder Projekt Bosco Verticale geschaffen hat, die aus 2.980 LEGO-Teilen besteht, fünf Stockwerke, Bewohner und viele Pflanzen umfaßt - sowie Solarpaneele auf dem Dach.

in Dubai
(Grafik)
Unter Vorwegnahme der chronologischen Darstellung: Auf der Klimakonferenz COP27 im November 2022 in Sharm El Sheikh, Ägypten, legt das italienische Architekturbüro den Plan für einen Vertical Forest-Wolkenkratzer in Dubai vor, der zwei spitz zulaufende Türme mit einer Höhe von 150 bzw. 190 m umfaßt. Zusammen sollen die Türme 2.640 Bäume und 27.600 Sträucher sowie ein System von Gewächshäusern und hydroponischen Gärten beherbergen.
Das Projekt in Dubai, das bislang nur ein Prototyp ist, soll laut veröffentlichtem Material eine Entsalzungsanlage und ein System zur Rückgewinnung von Grauwasser sowie PV-Paneele enthalten, um die Türme mit sauberer Energie zu versorgen.
Im Juli 2021 wird
im Botanischen Garten der Universität Freiburg der livMatS
Pavillon fertiggestellt und
der Öffentlichkeit präsentiert, der anschließend als Veranstaltungsort
und Demonstrationsobjekt für nachhaltiges Bauen mit Naturfasern.
Hinter dem innovativen Bauwerk stehen der Masterstudiengang ITECH
am Exzellenzcluster Integrative Computational Design and Construction
for Architecture (IntCDC) der Universität Stuttgart sowie
Biologen des Exzellenzclusters Living, Adaptive and Energy-autonomous
Material Systems (livMatS) der Universität Freiburg.

Der Pavillon gilt als das erste Gebäude mit einer durchgängigen Tragstruktur aus robotisch gewickelten Flachsfasern, wobei jedes der 15 Elemente etwa 5 m lang und rund 100 kg schwer ist. Daß der Bau mit einer Gesamtfläche von 46 m2 nur anderthalb Tonnen wiegt, wird durch das Material Flachs möglich, das in seinen mechanischen Eigenschaften synthetischen Glasfasern ähnelt, einer bionischen Gestaltung und der robotergestützten Fertigung.
Dabei plaziert ein Roboter Faserbündel auf einen Wickelrahmen, so daß das Bauteil automatisch und ohne Abfall oder Verschnitt wächst. Das kernlose Wickelverfahren, das eine hohe Materialeffizienz mit ebensolcher Tragfähigkeit verbindet, ist eine eigene Entwicklung der Universität Stuttgart.
Der Pavillon, der an Flechtwerke und Pflanzenstrukturen erinnert, ist für volle Schnee- und Windlasten ausgelegt und durch und durch natürlich. Einzig eine wasserdichte Haut aus Polycarbonat schützt die Fasern vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit.
Ebenfalls im Juli 2021 werden die Gewinner der Architizer A+Awards 2021 in einer Vielzahl von Kategorien bekanntgegeben, von denen hier der Preisträger in der Kategorie Wohnhaus, Privathaus (XL > 6.000 Quadratfuß, entsprechend etwa 557,42 m2) erwähnt werden soll. Dabei handelt es sich um das vom Architekten David Hertz in Los Angeles entworfene Sail House, das zwischen 2014 und 2021 auf der Insel Bequia - Teil des Staates St. Vincent und die Grenadinen - in der Karibik realisiert wurde.

Da es vor Ort bekanntermaßen schwierig ist, die erforderlichen Baumaterialien zu beschaffen, wird der gesamte Komplex vorgefertigt, flach verpackt und in 15 Schiffscontainern geliefert. Dadurch entsteht auch fast kein Abfall, der von der Insel hätte abtransportiert werden müssen.
Das Bauwerk besteht aus einem Haupthaus und mehreren Gästehäusern und bietet viel Platz für Unterhaltung und ein autarkes Design. Es ist nach seinen bemerkenswerten Zugdächern benannt, die von der Geschichte des Segelns in der Region inspiriert sind. Die Segel sind jedoch mehr als nur eine Hommage an die Kultur, denn sie dienen auch als Regensammelsystem und leiten das Wasser in Betonfundamente, die als Wasserspeicher dienen. Das System deckt den Wasserbedarf zu 100 %, und aus dem gespeicherten Wasser wird bei Bedarf Luft zur Kühlung des Raums gezogen.
Die tragende Konstruktion besteht aus korrosionsbeständigem Aluminium und ist mit recycelten Eisenholzplanken ummantelt, die von einem verlassenen Pier in Borneo stammen, ebenso wie die Plankenböden, Decks und die vertikalen Lamellen, die die tiefstehende Sonne und die vorherrschende Brise kontrollieren. Darüber hinaus verbessert die auskragende Dachlinie die Beschattung und Belüftung für eine natürliche Kühlung.
Im Inneren und Äußeren der Strukturen werden natürliche Materialien wie geflochtene Palmblätter, Kokosnußschalen und Oberflächen verwendet, die von javanischen und balinesischen Kunsthandwerkern hergestellt sind. Darüber hinaus ist das Sail House so konzipiert, daß es seinen gesamten Energiebedarf ganzjährig durch eine eigene Photovoltaikanlage deckt, die auf einem Nebengebäude steht. Genaue technische Angaben zur Leistung der PV-Anlage werden in den verfügbaren Quellen jedoch nicht genannt.
Auch Neuigkeiten zum ,Solarbaustoff’ Holz gibt es in diesem Jahr zuhauf. In einer Übersicht, die im Februar 2021 erscheint, werden einige Projekten beschrieben, die hier bislang nicht aufgeführt wurden aber als relevant für die Gesamtentwicklung gelten. Außerdem gibt es verschiedene materialbezogene Innovationen, die ausgesprochen erwähnenswert sind.
So wird Mitte 2012 in den Docklands von Melbourne Australiens
grünstes Apartmentgebäude fertiggestellt - denn der 10-stöckige
und 32 m hohe Luxus-Apartment-Turm
namens Forté ist zu diesem Zeitpunkt das höchste
Holzapartmentgebäude der Welt, das mit den als Brettsperrholz oder
CLT bekannten superstabilen Holzwerkstoffplatten gebaut wurde. Forté
bietet 23 Boutique-Apartments und ein Quartett von Stadthäusern.
Planer und Bauträger ist Lend Lease.
Mit acht Stockwerken und einer Höhe von 29,5 m ist das Wood Innovation and Design Centre (WIDC) in Prince George im Norden von British Columbia bei seiner Fertigstellung im Jahr 2014 das höchste Gebäude der Welt, das ausschließlich aus Holz gebaut ist.
Das von Michael Green und seinem gleichnamigen Architekturbüro realisierte Projekt im Umfang von 25 Mio. CA$, nutzt eine Reihe lokal hergestellter Holzwerkstoffe, darunter Brettsperrholz (CLT), Brettschichtholz (Glulam) und Furnierschichtholz. Verkleidet ist das WIDC mit Zedernholz. Es beherbergt einen Teil der University of Northern British Columbia sowie verschiedene Büros für Behörden und holzverarbeitende Unternehmen. Green ist übrigens Autor des 2017 erschienenen Buchs Tall Wood Buildings: Design, Construction and Performance.
Ab dem Herbst 2014 wird in Bergen, Norwegen, das 14-stöckige Wohnhaus Treet des Bauträgers Bergen and Omegn Building Society (BOB) gebaut, das im Dezember 2015 fertiggestellt und bezogen wird. Mit einer Höhe von 49 m gilt es zu diesem Zeitpunkt als höchstes Mehrfamilien-Holzwohnhaus der Welt. Treet beherbergt insgesamt 62 Luxuswohnungen, die als supereffiziente modulare Einheiten nach strengen Passivhaus-Standards in einer estnischen Fabrik hergestellt und dann zum Aufstellungsort verschifft und dort zusammengebaut wurden.
Ein bemerkenswerter Vorschlag ist auch das für Paris konzipierte Wolkenkratzerprojekt Baobab, das von Michael Green Architecture (MGA) gemeinsam mit dem lokalen Designstudio DVVD und dem französischen Immobilienentwickler REI France im Jahr 2015 beim Design-Wettbewerb Réinventer Paris eingereicht wurde.
Mit 35 Stockwerken und einer rekordverdächtigen Höhe von 120 m sollte der ganz aus Holz bestehende Turm Luxus- und erschwingliche Wohnungen, Einzelhandelflächen, Gemeinschaftsgärten und ein Busdepot umfassen. Das ambitionierte Vorhaben wurde jedoch nicht umgesetzt bzw. auf unbestimmte Zeit verschoben.

(Grafik)
Für Stockholm wird von Anders Berensson Architects im April 2016 ein hölzerner Wolkenkratzer namens Trätoppen vorgestellt - schwedisch für Baumkrone -, der direkt aus dem Dach eines Parkhauses aus den 1960er Jahren herausragen soll als ein urbanes Nachwachsen im wahrsten Sinne des Wortes: innovative und grüne neue Konzepte, die direkt aus alten Betonstümpfen sprießen.
Der von der Stockholmer Zentrumspartei in Auftrag gegebene Trätoppen, der sich 40 Stockwerke über das bestehende siebenstöckige Parkhaus erhebt, soll aus CLT gebaut und mit einer perforierten Holzfassade umhüllt werden, auf der man die einzelnen Etagennummern ablesen kann. Die Fassade hat auch einige praktische Vorteile und wirkt wie ein Sonnenschutz, der das Gebäude kühl und energieeffizient hält.
In dem 133 m hohen Holzturm werden 250 Wohnungen untergebracht, während die darunter liegende alte Garage in ein Einzelhandelszentrum mit Geschäften und Restaurants umgewandelt wird, in dem kein einziges Auto mehr steht. Um den Sockel des Hochhauses herum wird sich auf dem Dach des Parkhauses eine üppig bepflanzte öffentliche Terrasse erstrecken. Auch in diesem Fall gibt es keine Hinweise auf eine Realisierung oder einen Baubeginn.
Im Sommer 2017 wird auf dem Campus der University of British Columbia (UBC) in Vancouver der 18-stöckige Holz-Hybrid-Turm Brock Commons offiziell eröffnet, dessen Bau im November 2015 begonnen hatte. Das 53 m hohe Studentenwohnheim hat 404 Einzelzimmer.
Gemäß dem neuen Hochhausreglement der Stadt Zug in der Schweiz, das im August 2017 verabschiedet wurde und Gebäude bis zu 80 m Höhe an diesem Standort ermöglicht, wird im September 2019 der Siegerentwurf eines Wettbewerbs der Urban Assets Zug AG vorgestellt, dessen Ziel die Entwicklung eines innovativen Holzhochhauses mit Schwerpunkt auf nachhaltigem, bezahlbarem Wohnraum und sozialer Durchmischung ist.
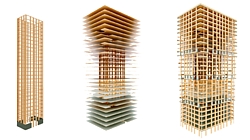
des Projekt Pi
(Grafik)
Das Besondere an dem Projekt Pi ist, daß das geplante 80 m hohe Holzhochhaus mit 27 Stockwerken im Unterschied zu bisherigen Bauten auf einen stabilisierenden Kern aus Beton verzichtet. Stattdessen greifen die Architekten und Ingenieure auf ein Tube-in-Tube-System (o. hull and core) zurück, wie es für Hochhäuser aus Stahl und Beton mit einer Höhe von über 300 m angewendet wird. Dabei stabilisieren ineinander greifende Röhrenstrukturen, die rundherum über alle Stockwerke laufen, das Gebäude gegen Windlasten. Im vorliegenden Fall werden horizontale und vertikale Lasten durch ein Rahmentragwerk aus Buchenholz und spezielle Holz-Verbund-Flachdecken aufgefangen, die eigentlichen Kernelemente der Konstruktion.
Zusätzlich wird das Gebäude mit PV-Modulen in der Fassade selbst zum Energieproduzenten und deckt damit zumindest einen kleinen Teil des Bedarfs der geplanten Wohnungen, Ateliers und Werkstätten. Nachdem der Baubeginn im neuen Tech Cluster Zug ursprünglich für das Jahr 2022 vorgesehen war, was durch komplexe Planungs- und Genehmigungsprozesse sowie Einsprachen jedoch verzögert wurde, ist er nun für das Jahr 2026 geplant.
Im Dezember 2019 gibt die Stadt Rotterdam bekannt, daß das Team um das Londoner Büro PLP Architecture den Wettbewerb des Bauträgers Provast für ein Hochhaus am Delftseplein gewonnen hat, einen Hybridholzturm mit dem Namen Tree House, der eine Höhe von 140 m erreichen soll. Die oberen Etagen werden 275 Wohnungen mit begrünten Balkonen enthalten, die unteren 15.000 m2 Büroflächen.
Ein Restaurant im siebten Stock wird auf eine bepflanzte Terrasse blicken, während im Erdgeschoß Geschäfte, Cafés und ein Veranstaltungs- und Aufführungsraum geplant sind. Darüber hinaus wird das Gebäude von drei Gewächshäusern gekrönt, und das Regenwasser wird gesammelt und zur Wiederverwendung gespeichert. Mit dem Bau des auf 160 Mio. € bezifferten Projekts soll 2021 begonnen werden, die Fertigstellung wird für 2024 erwartet, doch auch Mitte 2025 befindet es sich noch immer in der Planungs- und Genehmigungsphase.
Das Büro PLP Architecture ist uns im übrigen bereits mit dem 2014 fertiggestellten Bürogebäude The Edge und 2016 mit dem für London geplanten, 80-stöckigen Timber Tower begegnet (s.d.).

(Grafik)
Doch nun zu den aktuellen Projekten: Bereits Ende Januar 2021 präsentiert das norwegische Architekturbüro Mad Arkitekter aus Oslo die Pläne für ein 98 m hohes Hybrid-Holzhochhaus mit 29 Geschossen und einer Nutzfläche von 18.000 m2 - einschließlich angrenzender Flachbauten, die Teil des Projekts sind -, das in Berlin neben dem Anhalter Bahnhof entstehen soll. Hybrid deshalb, weil das Untergeschoß sowie die Kerne der vier Baukörper ganz klassisch aus Beton errichtet werden, und lediglich der Rest der Konstruktion aus Holz bestehen wird.
Der Entwurf hatte sich im Rahmen eines Realisierungswettbewerbs für das Wohnhochhaus WoHo in Berlin-Kreuzberg, der von der Unternehmensgruppe UTB ausgelobt wurde, gegen 13 Konkurrenten durchgesetzt. Das Budget beläuft sich auf etwa 90 Mio. €.
Geplant ist eine Mischnutzung, bei der 60 % sollen als Wohnraum dienen, während 25 % zu Gewerbeflächen werden und die restlichen 15 % für die soziale Infrastruktur eingeplant sind, wie beispielsweise eine Kindertagesstätte, Bäckereien, Cafés und Werkstätten, aber auch einen öffentlich zugänglichen Dachgarten, der eine Bar und eine Sauna sowie einige zusätzliche Außenterrassen umfassen wird. Neben einer großzügigen Verglasung ist auch die Begrünung der Fassade eingeplant. Das WoHo sollte bis 2026 fertiggestellt werden, befindet sich Mitte 2025 aber noch immer in der Planungsphase.
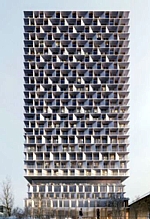
(Grafik)
Ebenfalls im Januar wird bekannt, daß die Pläne für den Tilia Tower der Architekturbüros 3XN und IttenBrechbühl im Vormonat als Siegerentwurf aus dem internationalen Wettbewerb hervorgegangen sind, den die Immobiliengesellschaft Insula AG ausgelobt und an dem 15 internationale Teams teilgenommen hatten.
Der gemischt genutztes Holzturm im Quartier Prilly-Malley am Stadtrand von Lausanne wird 85 m hoch sein, wobei allerdings noch nicht klar ist, ob er ganz aus Holz gebaut oder einen Betonkern haben wird. Die 37.000 m2 Nutzfläche des Gebäudes werden in Wohnungen, Einzelhandelsflächen, Restaurants, öffentlichen Räumen und ein Hotel aufgeteilt. Für den Turm wird eine strukturierte Fassade mit tiefen Fensternischen und Terrassen entworfen, die auch für eine optimale Belichtung und Beschattung sorgen sollen.
Als Teil des von der Insula SA und der Realstone Group entwickelten Gesamtprojekts werden außerdem ein angrenzendes bestehendes Bürogebäude und eine Badmintonhalle erhalten bleiben. Diese werden energetisch saniert und ihre Fassaden so umgestaltet, daß sie besser zu dem neuen Turm passen. Die Bauarbeiten beginnen im Frühjahr 2024, um voraussichtlich 2026 fertiggestellt zu werden.
Doch Holz kann nicht nur als Baumaterial genutzt werden. So veröffentlicht ein Team um Prof. Ingo Burgert, Prof. Francis Schwarze und Javier Ribera an der EMPA und der ETH Zürich im März 2021 die im Netz einsehbare Studie ,Enhanced mechanical energy conversion with selectively decayed wood’ über die Entwicklung von piezoelektrischem Holz, mit dem sich beispielsweise Strom aus dem Parkett gewinnen läßt. Das Team hatte bei früheren Forschungsarbeiten bereits hochfestes, wasserabweisendes sowie magnetisierbares Holz entwickelt.
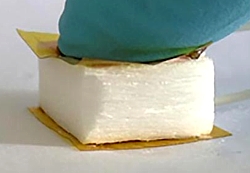
Nun wird über ein einfaches und umweltfreundliches Verfahren berichtet, um mit einem ,Schwamm’ aus Balsaholz eine elektrische Spannung zu erzeugen. Damit der natürliche piezoelektrische Effekt von Holz zum tragen kommt, dessen Zellwände aus den drei Grundstoffen Lignin, Hemizellulosen und Zellulose bestehen, wird das Lignin zumindest teilweise herausgelöst, indem das Holz in eine Mischung aus Wasserstoffperoxid und Essigsäure einlegt wird.
Der dabei entstehende weiße Holzschwamm besteht aus übereinanderliegenden, dünnen Zelluloseschichten, die sich einfach zusammenpressen lassen und sich dann wieder in ihre ursprüngliche Form ausdehnen. Ein Testwürfel aus diesem Material mit den Maßen 15 x 15 x 13,2 mm ist in der Lage, unter einem Druck von 45 kPa eine maximale Spannung von 0,87 V und einen Strom von 13,3 nA zu erzeugen. Zudem zeigt das Material eine erstaunliche Stabilität. 30 solcher Holzklötze, die parallel mit dem Körpergewicht eines Erwachsenen belastet werden, können ein einfaches LCD-Display zum Leuchten bringen.
Um das Verfahren so abzuwandeln, daß es ohne aggressive Chemikalien auskommt, nutzen die Forscher einen biologischen Prozeß: Der Weißfäulnis verursachende Pilz Ganoderma applanatum baut das Lignin und die Hemizellulose im Holz besonders schonend ab. Zudem läßt sich das umweltverträgliche Verfahren im Labor gut steuern.
In weiteren Experimenten will das Team nun die mögliche Skalierbarkeit dieses Nanogenerators untersuchen. Zudem werden bereits Gespräche mit potentiellen Kooperationspartnern geführt, um die Technologie für industrielle Anwendungen zu adaptieren, wie z.B. einen funktionalisierten Parkettboden, der die Trittenergie in Strom umwandelt - was bereits diverse Vorläufer machen, die im Kapitel Muskelkraft unter Treten und Tanzen aufgeführt sind (s.d.).

Skyscraper
For NY City
(Grafik)
Als im Mai 2021 die Sieger der diesjährigen eVolo Skyscraper Competition bekanntgegeben werden, steht an der Spitze der Living Skyscraper For New York City, der von einem großen Architekten- und Designer-Team aus der Ukraine stammt und wie eine Weiterentwicklung der derzeitigen Holztürme wirkt, die in Städten auf der ganzen Welt immer beliebter werden. Die Mitglieder sind Teil der Architekturszene in Lviv und agieren unter dem Namen Guess Line Architects.
Ihr Projekt verfolgt die visionäre Idee, genetisch veränderte, schnellwüchsige und hohe Laubbäume zu verwenden, die in Gruppen in speziell aufbereiteten Boden gepflanzt werden, um dann zu einem wirklich nachhaltigen Wolkenkratzer heranzuwachsen, der sowohl als Aussichtsturm mit eigener Flora und Fauna als auch als grünes Erholungszentrum dienen soll.
Dem Team zufolge würde dies auch inmitten einer grauen Megalopolis funktionieren und dabei eine Reihe von wichtigen Umwelt- und Stadtproblemen lösen. Ein lebender Wolkenkratzer-Baum wäre ein eigenständiger Organismus mit Wurzelsystem, Bewässerung, Pflegemechanismen und Entwicklungsmerkmalen, die auf seine Anpassung an die Architektur ausgerichtet sind.
Während die Pflanzen Wasser und Nährstoffe aufnehmen und von der Wurzel bis zur Spitze verteilen, werden durch das Wachstum des Stammumfangs gleichzeitig die Festigkeit der Holzstruktur allmählich erhöht und ihre selbsttragenden Eigenschaften verbessert. Und indem während der Entwicklung die Äste benachbarter Bäume auf verschiedenen Ebenen veredelt werden, bilden sie ein Netzwerk, die die Struktur stärkt und ihr Wachstum fortsetzt. Der Ansatz entspricht der architektonischen Richtung Baubotanik, über die am Ende der Jahresübersicht 2018 berichtet wurde (s.d.).

(im Bau)
Im Juli 2021 unterzeichnen die Landeshauptstadt Stuttgart und die Wolff & Müller Hoch- und Industriebau GmbH & Co. KG den Vertrag zum Bau des Bildungshaus NeckarPark, das mit einer Investition von 93,6 Mio. € das derzeit größte Einzelvorhaben der Stadt im Schulbereich ist. Entsprechend dem Entwurf der Kooperationspartner Glück + Partner GmbH Freie Architekten BDA und Pfrommer + Roeder Freie Landschaftsarchitekten BDLA IFLA wird das Gebäude auf 7.500 m2 im Neckarpark entstehen, dem neuen Wohn- und Gewerbegebiet auf der Fläche des ehemaligen Güterbahnhofs in Bad Cannstatt.
Das vergleichsweise niedrige Bildungshaus vereint eine vierzügige Grundschule, eine Sporthalle mit zwei Feldern, eine Kita für sieben Gruppen und ein Mittelzentrum der Volkshochschule in einem Gebäude. Hier wird es aufgeführt, weil es in Holzhybridbauweise errichtet wird. Das Untergeschoß mit Tiefgarage soll als Stahlbetonsockel ausgeführt werden; bei den darüber liegenden fünf Geschossen dominiert Holz als Konstruktionsmaterial. Das Bauwerk wird dadurch auch leichter und läßt die Heilquellen unberührt, in deren Schutzgebiet es errichtet wird.
Neben einer markanten Fassadenbegrünung wird auf dem Dach eine PV-Anlage mit einer Leistung von ca. 300 kW installiert, die als Gründachsystem ausgeführt wird. Der Bau beginnt im Sommer 2022, das Richtfest wird Ende Februar 2024 gefeiert, und die Eröffnung ist für das Schuljahr 2025/2026 geplant.

(Grafik)
Im September 2021 wird der symbolische Grundstein für das bislang höchste Holzhaus in Deutschland gelegt, das in der Hamburger Hafencity nahe der Elbbrücken entsteht und 65 m hoch werden soll. Bei dem Roots (früher: Wildspitze) genannten Haus mit 19 Stockwerken, das der Architekt Jan Störmer und sein Büro Störmer Murphy and Partners GbR entworfen haben, bestehen lediglich Fundament, zwei Untergeschosse und das Treppenhaus aus Beton. Für Decken, Wände und Fassade werden etwa 5.500 m3 Konstruktionsholz benötigt, zuzüglich der Holzmengen für alle nichttragenden Bauteile.
Da Holz ein knapper und entsprechend begehrter Baustoff auf dem Weltmarkt ist und die USA und China derzeit Unmengen an Holz aus Deutschland zu hohen Preisen aufkaufen, wird erwartet, daß das Holzhaus mit seinen 181 Wohnungen etwa 12 % teurer wird als ein Gebäude in herkömmlicher Bauweise, weshalb eine Investition von 140 Mio. € veranschlagt wird.
Entwickelt und koordiniert von der Firma Garbe Immobilien-Projekte GmbH werden 128 der 181 Wohnungen auf rund 20.600 m2 als Eigentumswohnungen vermarktet, 53 Wohnungen von der öffentlichen Hand mitfinanziert, und 80 % aller Wohnungen sollen bereits vergeben sein. Das 1. und 2. Obergeschoß sind auf einer Fläche von rund 1.700 m2 für eine Büronutzung ausgebaut und werden nach Fertigstellung durch die Deutsche Wildtier Stiftung genutzt.
Die Montage der ersten Holzelemente beginnt im Mai 2022 und die Fertigstellung ist für 2023 geplant, verzögert sich dann allerdings bis zum März 2024.

Bereits eröffnet wird im September 2021 im schwedischen Skellefteå das Sara Kulturhus (o. Kulturhuset) ein 19-stöckiges Hochhaus nebst einem niedrig gelegenen dreistöckigen Kulturzentrum mit der Hauptbibliothek der Stadt. Das gemischt genutzte Projekt umfaßt zudem ein Hotel mit Konferenzbereich, Restaurant und Spa sowie ein Theater und ein Museum. Das von der skandinavischen Megafirma White Arkitekter mit Hauptsitz in Göteborg entworfene Gebäude, das 2016 aus einem Designwettbewerb als Sieger hervorging, ist mit 75 m das höchste Holzgebäude in den nordischen Ländern.
Der beinahe 30.000 m2 große Komplex besteht zwar in erster Linie aus vorgefertigten 3D-Modulen aus Brettsperrholz (CLT), doch zur strukturellen Unterstützung werden auch Stahl und Beton verwendet, weshalb es sich bei dem Bauwerk um einen Hybrid-Holz-Wolkenkratzer handelt, auch wenn manchmal von einem Vollholzturm gesprochen wird. Das eingesetzte Holz stammt aus nachhaltiger regionaler Forstwirtschaft.
Die Außenseite des Gebäudes ist mit Sonnenschutzvorrichtungen versehen, um das Innere vor der 24-stündigen Sommersonne zu schützen, und Wärmepumpen sorgen für eine energieeffiziente Heizung und Kühlung. Insgesamt 1.200 m2 PV-Paneele reduzieren den Stromverbrauch, und ein integriertes KI-basiertes System paßt den Energieverbrauch je nach Belegung an.
Ebenfalls im September 2021 berichteten Wissenschaftler
der Universität Göttingen um Prof. Holger
Militz und des Schweizer Farb- und Chemieunternehmens Archroma über
eine neue Methode, mit der europäische Nadel- und Laubholzarten gezielt
behandelt werden können, um deren Feuerfestigkeit deutlich
zu erhöhen. Die innovative Technik nutzt spezielle Chemikalien, um
günstiges und ökologisches Holz aus europäischen Wäldern zu qualitativ
hochwertigem, feuerfestem Bauholz zu machen.

Es gelang schon zuvor, die Dimensionsstabilität, Wetter- und Wasserbeständigkeit sowie die Resistenz gegenüber holzzerstörenden Pilzen von einheimischen Holzarten zu verbessern, indem die Holzzellwand über eine Vakuum-Druck-Imprägnierung mit Kondensationsharzen modifiziert wurde. Bei erhöhter Temperatur reagieren die Harze mit der Zellulosefaser und bringen im Holz Eigenschaften ähnlich denen von Tropenhölzern hervor. Diese Technologie wurde nun gemeinsam mit der Archroma weiterentwickelt, die sie künftig auch weltweit exklusiv vermarkten soll.
Durch die Kombination der genannten Holzmodifikation mit einer Behandlung mit einem ungiftigen, für Textilgewebe entwickelten Flammschutzmittel, kann Holz mit den mechanischen Eigenschaften von Tropenhölzern sowie erhöhter Pilzresistenz hergestellt werden, das außerdem auch im Außenbereich langfristig feuerfest ist. Auf den Vergleichsfotos ist links das unbehandelte und rechts das behandelte Holz unter Beflammung zu sehen.
Ein Material mit solchen Eigenschaften ist von großem Interesse, da Holz ansonsten leicht entflammbar ist und besonders im Baubereich oft nicht die gesetzlichen Brandschutzanforderungen erfüllt. Zudem gibt es einen klaren wirtschaftlichen Vorteil: Weichholzbäume benötigen nur einen Bruchteil der Zeit, die ein tropischer Laubbaum zum Wachsen benötigt. Indem also dem Nadelholz die erforderlichen Eigenschaften des Laubholzes verliehen werden, kann auf bestehende, nachhaltig bewirtschaftete Wälder zurückgegriffen werden, um das dauerhafte Holz zu erzeugen, das für Bauanwendungen benötigt wird.
Bei den peripheren Informationen geht es in diesem Jahr in erster Linie um neue Entwicklungen bei der Dämmung und dem Betonbau.
Im März 2021 veröffentlicht ein Team der Freien Universität Bozen um Marco Caniato die Studie ,Acoustic and thermal characterization of a novel sustainable material incorporating recycled microplastic waste’, in welcher es über einen interessanten Ansatz berichtet, die problematischen, im Meer schwimmenden Mikroplastik-Teilchen zur Herstellung eines Dämmstoffs zu nutzen.

aus Mikroplastik
Deren Wiederverwertung ist oftmals problematisch, da die Teilchen nicht sortenrein, oft mit anderen, nicht aus Plastik bestehenden Partikeln vermischt und zudem von Meersalz überzogen sind. Die heterogene Zusammensetzung des maritimen Mikroplastiks macht es nahezu unmöglich, aus ihm neue Kunststoffteile zu erschaffen, weshalb aus dem Meer entferntes Mikroplastik oft auf Deponien landet oder verbrannt werden muß.
Der Plan, aus dem heterogenen Mikroplastik einen Dämmstoff machen, entstand aus der Beobachtung, daß das natürliche Geliermittel Natriumalginat nicht nur eine gelartige Konsistenz aufweist, sondern auch poröse, festere Strukturen bilden kann. Für ihre Experimente stellen die Forscher Mikroplastik-Mischungen her, die in ihren Partikelgrößen sowie der Zusammensetzung dem maritimen Mikroplastik entsprechen. Diese Mischungen versetzen sie dann mit flüssigem Alginat, dem zuvor Calciumkarbonatpulver als Bindemittel hinzugegeben wurde.
Indem die Calcium-Ionen des Karbonats mit den Molekülketten des Alginats reagieren, werden Querverlinkungen ausgebildet und eine poröse Grundmatrix entsteht. Die Alginat-Plastik-Mischung bildet so eine poröse Struktur, deren Hohlräume mit Wasser gefüllt sind, das sich durch Gefriertrocknung entfernen läßt, womit ein fester, trockener Hartschaum aus Plastikteilen und Alginat entsteht, der in Konsistenz und Bearbeitungseigenschaften klassischen Dämmstoffen aus dem Gebäudebau ähnelt. Das Wasser, das am Ende der Gefriertrocknung nach dem Auftauen abgegeben wird, wird wiederverwendet.
Tests bestätigen, daß das Produkt hervorragende Dämmeigenschaften hat und problemlos mit herkömmlichen Dämmstoffen wie Steinwolle oder Polyurethanschaumstoffen mithalten kann, auch bezüglich der Schalldämmung und der Wärmeisolierung. Dabei ist es egal ist, aus welchen Kunststoffen das Mikroplastik besteht oder ob seine Partikel gleich groß sind.
Zudem ist der Grundstoff Alginat biologischen Ursprungs, so daß die patentierte Methode auch umweltfreundlich ist. Caniato entwickelte das Biopolymer in Zusammenarbeit mit Chiara Schmid von der Universität Triest aus einem Extrakt der Meeresalge Agar Agar. Bislang mangelt es allerdings noch an einem effektiven und günstigen Verfahren, mit dem die Mikroplastikpartikel aus dem Meer entfernt werden können. Caniato ist übrigens ab Oktober 2024 Professor an der HFT Stuttgart.
Im April 2021 geht ein sechsjähriger Wettbewerb
zur Abscheidung von CO2-Emissionen aus in Betrieb befindlichen
Kraftwerken und deren Umwandlung in nützliche Produkte zu Ende. Der
mit insgesamt 20 Mio. $ dotierte Carbon XPrize startete 2016 mit
fast 50 Teams aus aller Welt, die 2018 auf zehn
vielversprechende Finalisten reduziert wurden. Diese Teams mußten
ihre Technologien dann in einem Kohlekraftwerk in Wyoming oder in
einem erdgasbefeuerten Kraftwerk im kanadischen Calgary demonstrieren,
wo schließlich zwei Gewinner ermittelt wurden.
Bei diesen handelt es sich um zwei Teams aus Nordamerika, die nachweisen, daß ihre Ansätze erhebliche Mengen an CO2 entfernen und daraus Beton herstellen können, der die gleiche oder sogar eine bessere Leistung aufweist als das herkömmliche Material.
Das kanadische Start-Up CarbonCure Technologies erhält 7,5 Mio. $ für eine Methode, bei der eine hochspezifische Menge an abgeschiedenem CO2 in das Rückgewinnungssystem eines Betonwerks injiziert wird, wo es mit den Kalziumionen im Zement reagiert und ein Mineral in Nanogröße bildet, das in Betonmischungen eingearbeitet werden kann und dessen Druckfestigkeit um bis zu 10 % erhöht. Dank dieser Rezepturänderung kann der Beton mit weniger Frischwasser, weniger Abfall und vor allem mit weniger Zement hergestellt werden.
Den gleichen Betrag erhält das Team CarbonBuilt von der University of California, Los Angeles (UCLA) für eine Technologie die die Abscheidung von CO2 aus den Rauchgasströmen von Kraftwerken oder Zementfabriken und dessen direkte Injektion in die Betonmischung vorsieht, wo es umgewandelt und dauerhaft gespeichert wird. Der Ansatz reduziert den CO2-Fußabdruck von Beton um mehr als 50 % und verringert die benötigte Menge an herkömmlichem Portlandzement um 60 - 90 %, gleichwohl dieser Beton genauso stark und haltbar ist wie herkömmlicher Beton.
Über eine neue Technik zur Herstellung von Beton, bei der Betonabfälle recycelt
und mit abgeschiedenem Kohlendioxid kombiniert werden, wird im Oktober 2021 berichtet
(,A New Concept of Calcium Carbonate Concrete using Demolished Concrete
and CO2’).
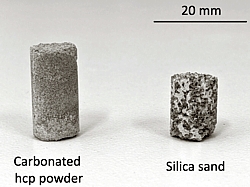
Ein großes Team der Universität Tokio und weiterer japanischer Universitäten sowie den beiden Firmen Taiheiyo Cement Corp. und Shimizu Corp. hat demnach ein Verfahren entwickelt, das den ökologischen Fußabdruck von Beton gleich in mehrfacher Hinsicht verringert. Zum einen wird das neue Material aus altem Betonschutt hergestellt, der oft auf Deponien landet. Zudem kann das Verfahren bei etwa 70°C durchgeführt werden, was sehr weit unter den mehr als 1.000°C liegt, die zum Brennen von Kalkstein erforderlich sind. Ein weiterer Vorteil ist, daß das eingemischte Kohlendioxid entweder aus Industrieabgasen oder direkt aus der Luft gewonnen werden kann.
Für Tests werden Musterblöcke aus zwei gängigen Bauabfallprodukten hergestellt: Zementstein (HCP) bzw. Quarzsand. Das Verfahren beginnt mit einer Kalziumbikarbonatlösung, die aus Kalksteinpulver, entionisiertem Wasser und Kohlendioxidgas besteht. Diese Lösung wird dann in eine Form gepumpt, die einen der Zuschläge - entweder HCP-Pulver oder Quarzsand - enthält, der dann auf 70°C erhitzt wird. Das Endergebnis ist ein Block aus einem neuen Material, das das Team Kalziumkarbonatbeton nennt.
Bislang liegt die durchschnittliche Druckfestigkeit der Blöcke aus dem kohlenstoffneutralen Kalziumkarbonatbeton allerdings erst bei 8,6 MPa, was weit unter den 20 - 40 MPa von Beton aus Portlandzement liegt. Dies soll nun durch weitere Arbeiten verbessert werden. Außerdem soll der Energieverbrauch des Produktionsprozesses weiter gesenkt werden.
Zum Abschluß dieser Jahresübersicht ist noch ein Projekt der außerirdischen
Architektur zu erwähnen. Auf der 17. Internationalen
Architekturausstellung der Biennale di Venezia, die im Mai 2021 beginnt,
stellen die Architekten von Skidmore, Owings & Merrill (SOM)
ein Monddorf vor, das als visionäres Konzept für die erste permanente
menschliche Siedlung auf der Mondoberfläche in Zusammenarbeit mit
der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und
dem Massachusetts Institute of Technology (MIT)
entwickelt wurde. Die erste Konzeptpräsentation war bereits 2019 auf
der Architektur-Biennale gezeigt worden.

(Grafik)
Das Moon Village ist in erster Linie als eine Ansammlung von Forschungsstationen konzipiert und soll eine Reihe von Funktionen beherbergen, die von der Nachhaltigkeitsforschung bis hin zum zukünftigen Mondtourismus reichen. Der Standort am Rande des Shackleton-Kraters in der südlichen Polarregion des Mondes bietet die Möglichkeit einer autarken Siedlung, die nahezu ganzjährig Sonnenlicht erhält, das zur Energiegewinnung genutzt und gespeichert werden kann. Auf der Abbildung sind regelrechte ,Wälder’ aus senkrecht stehenden PV-Paneelen zu sehen.
Dem Bauplan zufolge ist das strukturelle Design der 3 - 4 Stockwerke hohen Module ein hybrides starr-weiches System, das aus zwei Schlüsselelementen besteht: einem starren, tragenden Gerüst aus einer Titanlegierung als Verbundrahmen und einer aufblasbaren strukturellen Hülle, die einen mehrschichtigen Aufbau mit einem Umweltschutzsystem umfaßt. Damit lassen sich die Baumaterialien der einzelnen Strukturen leicht per Rakete transportieren.
Die Kombination aus einem starren Gerüst und einer aufblasbaren Hülle aus Polyurethan mit offenem Schaum und doppelt aluminisiertem Mylar zur Isolierung wurde von SOM auch gewählt, um sich an die internen und externen Umweltbedingungen anzupassen, die Luftzirkulation zu optimieren und transparente Arbeitsräume zu erhalten, während das freie, zentrale Volumen die Effizienz der Forschungsprojekte fördert. Das Projekt ist weiterhin Gegenstand internationaler Forschung und wird regelmäßig in Ausstellungen und Fachpublikationen präsentiert, zuletzt 2023 in Paris.
Eine besondere Form der solaren Architektur bilden die Solarsiedlungen, die als nächstes vorgestellt werden. Anschließend folgen die Beschreibungen von Heliostaten (als Tageslicht-Systeme) sowie verschiedener weiterer solarer Nutzungsformen.
Weiter mit den Solarsiedlungen ...